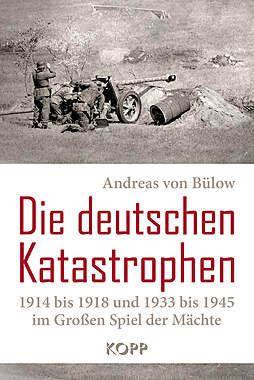-->βÄûIch habe Angst vor unsβÄ€
Der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace ist ΟΦber sich und seine Landsleute verstΟΕrt
Interviews gibt David Foster Wallace ΟΛuΟüerst selten. Das folgende GesprΟΛch hΟΛtte er am liebsten noch am Vortag abgesagt; auf den Vorschlag, ihn zu Hause zu treffen, reagiert er abweisend: unmΟΕglich, seine beiden Hunde seien ausgesprochen bissig. Also findet das Interview in einem trostlosen Hotel statt, in dem Wallace nervΟΕs, aber pΟΦnktlich und schicksalsergeben erscheint. Der Rebell der amerikanischen Literatur zeigt sich - zum eigenen Entsetzen - fast altmodisch: ohne Zynismus und voller Angst vor einem Krieg mit dem Irak. Mit Wallace sprach Miriam BΟΕttger.
DIE WELT: In Ihren Romanen und Kurzgeschichten geht es meist um Ihre eigene Generation. Was ist denn so besonders an ihr?
David Foster Wallace: Ich bin jetzt vierzig Jahre alt, bin also Anfang der Sechziger geboren. Das Problem meiner Generation ist, dass wir uns immer noch selbst als Kinder betrachten, als Kinder mit Eltern. Wir wollen einfach nicht erwachsen werden. Und unsere Kultur nutzt das aus und bedient genau das in uns, was Kind bleiben mΟΕchte, sie fΟΕrdert alles an dir, was infantil, selbstsΟΦchtig, und gierig ist.
DIE WELT: Das klingt als geschehe das mit System...
Wallace: Allerdings. Kinder in den USA lernen sehr frΟΦh, dass es nur darum geht, was man selbst will. Das ist die amerikanische Ethik, und man kann sich vorstellen, dass sie viel dazu beitrΟΛgt, die Konsum- und Unterhaltungsindustrie am Laufen zu halten. Diese Botschaft ΟΦbt einen groΟüen Reiz auf den Mensch als Individuum aus: βÄûEs gibt kein hΟΕheres Gut als das eigene WohlβÄ€ - das hΟΕrt jeder gern. NatΟΦrlich nehmen dich deine Eltern nicht beiseite und sagen zu dir: βÄûAlso, Junge, denke in deinem Leben nur an dich.βÄ€ Das funktioniert viel subtiler. Aber de facto ist das, was unser System tausendmal am Tag sagt.
DIE WELT: Was ist so gefΟΛhrlich daran?
Wallace: Die amerikanische Gesellschaft und Wirtschaft, die darauf grΟΦnden, ihren BΟΦrgern Waren anzudrehen, versagen dann, wenn es darum geht, Kinder zu erziehen, oder den Menschen eine Ahnung von GlΟΦck zu geben - wenn dieses Wort ΟΦberhaupt noch etwas bedeutet. Das ist doch kein GlΟΦck, wenn man jedem seiner Impulse blind folgen und jedes Verlangen befriedigen muss. FΟΦr mich ist das eine Art von Sklaverei. Aber niemand nennt es so, statt dessen hΟΕrt man Schlagworte wie βÄûFreiheit der WahlβÄ€ und βÄûRecht auf Konsum.βÄ€
Das Interessante ist doch: wΟΛhrend ich hier sitze und ΟΦber all diese Dinge rede, schΟΛme ich mich gleichzeitig zu Tode, denn ich klinge wie mein eigener GroΟüvater. Wie ein alter Mann, der moralische VortrΟΛge hΟΛlt, die keiner hΟΕren will. In Amerika macht einen so was leicht zur Witzfigur. TatsΟΛchlich hΟΕre ich in meinem Kopf in diesem Moment eine Stimme, die sich ΟΦber mich lustig macht. Und genau das ist die paradoxe Situation, in der man als halbwegs intelligenter Amerikaner steckt. Eigentlich weiΟü man, was gut und richtig ist, aber stΟΛndig gibt es da diese Ablenkungen, man sagt sich: Hey, sei doch kein Spielverderber.
DIE WELT: Haben Sie einen Fernseher?
Wallace: Nein, manchmal sehe ich bei Freunden fern. Aber wenn ich einen eigenen Fernseher hΟΛtte, dann wΟΛre der Tag und Nacht in Betrieb und ich wΟΛre fΟΦr nichts anderes mehr zu gebrauchen. In dieser Beziehung bin ich kein StΟΦck anders als die meisten Menschen. Ich bin genauso gierig nach allem, was das Auge reizt.
<ul> ~ Quelle --> Welt</ul>
|
 Thread-Ansicht
Thread-Ansicht Mix-Ansicht
Mix-Ansicht