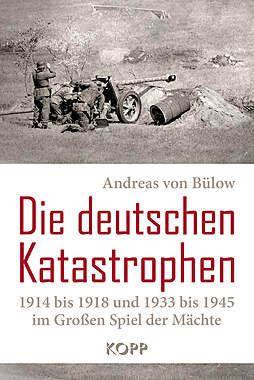Die Furcht vor dem Börsenkrach
Es sei wirklich ein Wunder, daĂ Amerika nach dem Krieg von einer wirtschaftlichen Katastrophe des AusmaĂes von 1929 verschont geblieben sei, schrieb der Nationalökonom John Kenneth Galbraith Anfang der sechziger Jahre in seinem Buch âThe Great Crash 1929". Einen Grund sah er darin, daĂ sich die âbitteren Erfahrungen" tief ins nationale BewuĂtsein eingeprĂ€gt hĂ€tten.
Vierzig Jahre spĂ€ter wissen wir, daĂ solche PrĂ€gungen mit der Zeit verblassen. An den Börsen wird wie eh und je spekuliert, werden Gewinne und Verluste gemacht. Wenn die âMassenflucht aus der Wirklich-keit" (Galbraith) heute auch realistische-ren Marktbeurteilungen gewichen ist, nicht zuletzt dank besserer Informations-möglichkeiten - die Gier nach schnellem Reichtum ist geblieben. Man kann es auch positiv wenden: Wirtschaftliche und techni-sche Zukunftsphantasien werden immer wieder GegenstĂ€nde finden, an denen sie sich entzĂŒnden, zum Beispiel an den mitun-ter grandiosen (oder abenteuerlichen) Vi-sionen der Matadore des Neuen Markts. Chancen und Risiken liegen dicht beieinan-der. Wiederholt sind (kleinere) Spekulati-onsblasen geplatzt.
Dennoch hat sich das zerstörerische Ge-schehen von 1929 weder an den Börsen noch in den Volkswirtschaften der groĂen IndustrielĂ€nder wiederholt. In den Jahren 1987,1990 und 1998 haben sich die Aktien-kurse nach erheblichen Kursverlusten je-weils wieder erholt und sind nach einer Ver-schnaufpause ĂŒber die alten HöchststĂ€nde hinausgewachsen. Der Index der amerikani-schen Industrieproduktion kam in den Bais-seperioden mit einer mĂ€Ăigen Delle davon, so auch am Ende des vergangenen Jahres nach dem sukzessiven Kursrutsch, der im MĂ€rz am Neuen Markt begonnen hatte.
1929 indes war der Index binnen vier Mo-naten um 8 Prozent (Galbraith), nach ande-ren Quellen sogar um 20 Prozent zurĂŒckge-gangen und hatte die Einzelhandelspreise mit nach unten gerissen. Dies alles schon vor den senkrechten KursstĂŒrzen vom 24. Oktober. Insofern ist die Frage, wo der Ur-sprung der Börsenkrise lag - in der Ăber-spekulation oder in handfesten realwirt-schaftlichen AbbrĂŒchen -, nicht ganz unbe-rechtigt. Am Ende griff eins ins andere.
Heutzutage stĂŒrzt in Amerika der indu-strielle Produktionsindex in Baisseperi-oden der Börse nicht mehr nach unten, und schon gar nicht lotrecht, sondern er bĂŒĂt (gesamtindustriell) allenfalls an Wachstum ein. Nur zyklisch empfindliche Teilindizes wie der Automobil- oder der Wohnungs-bau fahren die Kurven deutlicher aus. Ein gesamtwirtschaftlicher Wachstumsverlust von zwei Punkten gilt dann schon als âharte Landung", an die sich sogleich allerlei Re-zessionsorakel knĂŒpfen. Nach einigen Mo-naten weichen diese wieder hoffnungsvolle-ren Voraussagen. Der groĂe Crash ist, zur allgemeinen Ăberraschung, ausgeblieben.
Die Ursachen des Börsenkrachs von 1929 waren vielschichtig. Begonnen hatte al-les mit dem Rausch der goldenen zwanzi-ger Jahre, in denen sich ungeahnte Perspek-tiven eröffneten. Stichworte sind das FlieĂ-band, die Massenproduktion von Autos, der Beginn des Flugzeug-Zeitalters, Rund-funk, Tonfilm - lauter zukunftstrĂ€chtige Entwicklungen. KrĂ€ftige ProduktivitĂ€tsstei-gerungen bei zurĂŒckbleibenden Löhnen hielten die Preise in den Vereinigten Staa-ten stabil, beförderten das Wachstum und minderten die Arbeitslosigkeit. SteuerermĂ€-Ăigungen und eine liberale Handelspolitik unterbauten den ProsperitĂ€tsschub, der breite Schichten erfaĂte. Ein goldenes Zeit-alter schien angebrochen. Die Börsen boomten, die Anleger hielten mit.
In Zeiten des Booms gebar Wall Street die unheilvollen Investmenttrusts
Aber der Boom hatte auch seine Schat-tenseiten. Wall Street gebar eines der un-heilvollsten Finanzierungsinstrumente, die es je gegeben hat: die Investmenttrusts. Sie haben mit den heutigen Investmentfonds nur gemein, daĂ sie Gelder von Anlegern einsammelten und diese in Aktien anleg-ten. Aber die damaligen Trusts nahmen zu-sĂ€tzlich Fremdkapital mit Hilfe von festver-zinslichen Papieren auf, verschachtelten sich unter- und ĂŒbereinander zu schwer durchschaubaren, pyramidenförmigen Ge-bilden, erreichten 1929 immerhin die Bör-senzulassung und wurden bis zu 50 Prozent ĂŒber ihrem Inventarwert gehandelt.
Vermittels des sogenannten Leverage-Effekts, der Hebelwirkung des (an der Vermö-gensmehrung durch Kursanstieg nicht betei-ligten) Leihkapitals auf die Kurse des (weit-aus kleineren) Aktienkapitals der Trusts, wurden die Notierungen und damit das vir-tuelle Vermögen in immer luftigere Höhen getrieben. Im Extremfall bewegte ein Aus-gangskapital von 500 Dollar am Ende (und an der Spitze der Pyramide) ein Trust-Ver-mögen von einer Milliarde Dollar. Die Sa-che hatte den Haken, daà Pyramide und Hebel bei fallenden Kursen ihre multiplizie-rende Wirkung auch in umgekehrter Rich-tung entfalteten. Das war eine der schmerz-haften Lektionen des 24. Oktober 1929.
Wie immer in solchen fiebrigen Situatio-nen gab es dubiose NeugrĂŒndungen von Aktiengesellschaften, die auĂer einer Ge-schĂ€ftsidee nichts vorzuweisen hatten. Sie reĂŒssierten dennoch an der Börse, vor al-lem 1929, als das Aktienangebot im Boom immer knapper und teurer wurde. Solche windigen Offerten, technisch nur raffinier-ter verbrĂ€mt, werden dem zeitgenössischen Leser nicht unbekannt vorkommen.
Und es gab Wertpapierkredite fĂŒr Anle-ger (Margin loans), vermittelt von Maklern (Brokern) gegen VerpfĂ€ndung der ange-kauften Aktien, mit unterschiedlichen Bar-einschĂŒssen und NachschuĂpflicht, falls das Pfandvermögen sich durch KurseinbrĂŒche nachhaltig vermindern sollte. Die Margin loans erreichten am Ende des Booms ein Volumen von 8,5 Milliarden Dollar, rund 10 Prozent der Kapitalisierung am damali-gen amerikanischen Aktienmarkt. Im Som-mer 1929, als das Börsenkarussell sich im-mer schneller drehte, stiegen sie um 400 Millionen Dollar monatlich. Zur VerstĂ€r-kung des Börsenkrachs trugen die Margins auf naheliegende Weise bei: Die Broker ver-langten NachschĂŒsse, und wenn diese nicht erbracht werden konnten, wurden die Ak-tiendepots anteilig zwangsweise liquidiert und verkauft. Das geschah nach dem 24. Oktober in immer neuen Wellen, den Kurs-einbrĂŒchen folgend und diese verstĂ€rkend.
Das sind die wichtigsten Faktoren, die den Boom der zwanziger Jahre unterhiel-ten. An ihnen lassen sich freilich auch die Unterschiede verdeutlichen, die die heutige Lage von der damaligen trennen. Auch im vergangenen Jahrzehnt hat es in Amerika ein stetig steigendes Volumen von Wertpa-pierkrediten vom Typ der Margin loans ge-geben. Es erreichte Ende MĂ€rz 2000, auf dem Gipfel des jĂŒngsten Booms, einen Höchststand von 278 Milliarden Dollar. Doch das waren nicht 10 Prozent, sondern 1,7 Prozent der Marktkapitalisierung von 16 Billionen Dollar in New York. Bis Ende November wurden die Maklerkredite auf 219 Milliarden Dollar zurĂŒckgefĂŒhrt, zwei-fellos zum Teil durch ZwangsverkĂ€ufe von verpfĂ€ndeten Aktien (oder Fonds). Es gab zwei charakteristische AbwĂ€rtsschĂŒbe von je 10 Prozent des Volumens im April und im Oktober/November 2000. Aber darĂŒber ist der Aktienmarkt nicht zusammengebro-chen, ebensowenig wie 1998 nach dem Kurseinbruch im Juli, als die Margin loans von August bis Oktober um 15 Prozent zu-rĂŒckgingen; danach stiegen sie wieder.
Hier ist die Gelegenheit, auch mit einer anderen Legende aufzurĂ€umen. Die Schul-den des amerikanischen Durchschnitts-haushalts mögen hoch sein; immerhin be-ansprucht der Schuldendienst im Mittel heute fast 14 Prozent der verfĂŒgbaren Ein-kommen. Aber die Suggestion, daĂ dahin-ter vor allem die Wertpapierkredite fĂŒr Spe-kulationen stecken, geht fehl. Diese mach-ten Mitte vergangenen Jahres 17 Prozent der Konsumentenkredite aus. Der Konsu-mentenkredit schlĂ€gt aber in der Schulden-bilanz amerikanischer Haushalte nur mit 30 Prozent zu Buche; 70 Prozent der Ver-schuldung betreffen Haus- und Grundbe-sitz in Gestalt von Hypotheken. Der Anteil der Wertpapierkredite belĂ€uft sich dem-nach im Durchschnitt auf 5 Prozent des ge-samten Schuldenbudgets. Unter anderem deshalb halten sich die Börsenfolgen von Margin calls (Anrufe von Maklern wegen eines Nachschusses) heute in den Grenzen, die im November 2000 zu besichtigen wa-ren. Im ĂŒbrigen haben die Leute nicht nur mehr Schulden, sondern auch gröĂere Ver-mögen - vor allem jene, die Aktien halten.
Der Krach von 1929 war kein ephemeres Ereignis von kurzer Dauer. Er war ein lan-ger ProzeĂ von elementarer Zerstörungs-kraft, der sich ĂŒber fast drei Jahre hinzog, die Kurse im Durchschnitt auf 10 Prozent der einstigen HochstĂ€nde drĂŒckte, eine Depression auslöste, die Wirtschaft verwĂŒ-stete, das Bruttosozialprodukt'bis 1932 um ein Drittel schrumpfen lieĂ. 85 000 Unter-nehmen und jedes fĂŒnfte Kreditinstitut ko-stete er die Existenz. Am Ende waren acht Millionen Sparkonten vernichtet, weil es keinen Einlegerschutz gab.
Warum verlaufen Börsenkrisen heute ganz anders? Eingefleischte Börsianer wĂŒrden als wichtigsten Grund vielleicht ei-nen Namen nennen: Alan Greenspan. In der Tat hat die souverĂ€ne Art, in der der amerikanische NotenbankprĂ€sident sein Amt ausĂŒbt, viel Vertrauen geschaffen. Das ist die wohl wichtigste Voraussetzung fĂŒr einen Börsenverlauf, der zwar nicht im-mer geradlinig und störungsfrei sein kann, die unvermeidlichen Wendungen und Ab-stĂŒrze aber in zutrĂ€glichen Grenzen hĂ€lt.
Wie Greenspan die amerikanische Zins- und LiquiditĂ€tspolitik in den Baissen von 1987 und 1998 (und auch jĂŒngst wieder) ge-steuert hat, wie er die Kreditinstitute im entscheidenden Moment âgeflutet" und da-mit Kreditklemmen vorgebeugt hat - ob-wohl aus GrĂŒnden der PreisstabilitĂ€t viel-leicht anderes angezeigt gewesen wĂ€re -, das hat die Ăberzeugung gestĂ€rkt, daĂ Bör-senkrisen kein Weltuntergang mehr sind. Ausgezahlt hat sich das Vertrauen im Pro-speritĂ€tsschub, den die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahrzehnt erlebt haben.
Noch 1987 hatten die groĂen Aktien-fonds diesseits und jenseits des Atlantiks im Gefolge des Kurseinbruchs im Okto-ber mit starken MittelabzĂŒgen der Anle-ger zu kĂ€mpfen; das hielt in Amerika bis MĂ€rz 1989 an. Die Tabelle ĂŒber die Netto-
ZuflĂŒsse bei amerikanischen Aktienfonds in den vergangenen drei Jahren zeigt fĂŒr 1998 und fĂŒr das von KursrĂŒckgĂ€ngen be-sonders betroffene Jahr 2000 ein ganz an-deres Bild. Der Schrecksekunde vom Juli 1998 folgt im August zwar ein Nettoabzug, aber schon im September wendet sich der Saldo ins Positive. Zu beachten ist der star-ke ZufluĂ bei den Geldmarktfonds im Au-gust. Er dĂŒrfte bedeuten, daĂ die Anleger die BĂŒhne nicht verlassen, sondern ein In-termezzo in angenehm liquider Umge-bung absolvieren.
Im abgelaufenen Jahr blieben die Zu-fluĂsalden bei den Aktienfonds nach den KurseinbrĂŒchen vom MĂ€rz bis zum De-zember durchweg positiv - mit BetrĂ€gen, die sich mit den Vorjahresmonaten abso-lut messen konnten, diese bis September sogar Monat fĂŒr Monat ĂŒbertrafen. In Deutschland sieht die Bilanz beider Jahre bei den Aktienfonds genauso aus. GeplĂŒn-dert worden sind im vergangenen Jahr ĂŒberall die Rentenfonds (wegen der erwar-teten KursrĂŒckgĂ€nge bei steigenden Zin-sen), aber nicht die Aktienfonds. Profi-tiert haben in den SchwĂ€cheperioden ge-nerell die Geldmarktfonds - mutmaĂlich als Parkstationen fĂŒr die Zeit bis zum nĂ€chsten BörsenfrĂŒhling.
Die Gelassenheit der Anleger geht nicht allein auf Greenspans Konto
Diese bemerkenswerte Gelassenheit der Anleger allein auf das Konto von Alan Greenspan zu buchen wĂ€re verfehlt. Die Bedingungen, unter denen die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks heute arbeiten, unterscheiden sich grundlegend von denen des Jahres 1929. Das gilt fĂŒr die staatliche Aufsicht ebenso wie fĂŒr den Anleger-schutz, fĂŒr die Einlagensicherung der Bank-kunden wie fĂŒr die Transparenz des gesam-ten Börsengeschehens. Der letzte Punkt be-trifft unter anderem die prompte Kursinfor-mation, die am 24. Oktober 1929 völlig zu-sammenbrach und die Panik der Anleger steigerte - mit schlimmen Folgen fĂŒr die Höhe der anschlieĂenden Verkaufswogen.
Zu Beginn der KurseinbrĂŒche von 1987 war die KursĂŒbermittlung in New York wie-der in RĂŒckstand geraten, wenn auch nur kurz und ohne eine Panik wie 1929 hervor-zurufen. Daraus hat man eiligst Konsequen-zen gezogen und die Systeme verbessert.
Zur verbesserten Transparenz gehören heute nicht nur die Berichtspflichten der Aktiengesellschaften und die Vorschriften ĂŒber Börsenprospekte mit ihren inhaltli-chen Vorgaben, sondern auch die unzĂ€hli-gen offenen, jedermann zugĂ€nglichen Pu-blikationen ĂŒber das Börsengeschehen, die Verfassung der MĂ€rkte und die Befind-lichkeit von Einzelunternehmen aus der Fe-der von Journalisten und Analysten. In Deutschland haben ĂŒberdies die Gerichte eingegriffen und die Anforderungen an den Wahrheitsgehalt der Kundenberatung bei Finanz- und Kreditinstituten verschĂ€rft.
Das alles schafft mehr Vertrauen. Die AufzĂ€hlung stabilisierender Faktoren am Aktienmarkt wĂ€re jedoch unvollstĂ€ndig, wenn nicht auch der Rolle der Pensions- -und Investmentfonds gedacht wĂŒrde, de-nen auf den MĂ€rkten - vor allem der Verei-nigten Staaten - seit Jahren wachsendes Ge-wicht zukommt. In den vergangenen Jahr-zehnten sind sie aus kleinen AnfĂ€ngen zu groĂen Finanzunternehmen aufgestiegen und halten heute, zusammen mit Versiche-rungen und Banken, rund die HĂ€lfte des amerikanischen Aktienmarkts in HĂ€nden. Ende 1999 standen von den 16 Billionen Dollar Marktkapital an Aktien nicht weni-ger als 25,1 Prozent im Besitz von (privaten und staatlichen) Pensionsfonds, 8,2 Prozent lagen bei Versicherungen und Banken und immerhin 16,8 Prozent bei Investment-fonds. Die Direktanlage der Privathaushal-te in Aktien ist in Amerika in den vergange-nen fĂŒnfzig Jahren von 90 auf 40 Prozent ge-schrumpft - und im gleichen Umfang auch das Panikpotential in kritischen Phasen.
In Deutschland sieht nach Untersuchun-gen der Bundesbank die EigentĂŒmerstruk-tur bei Aktien zur gleichen Zeit deutlich an-ders aus: Hier sind es die Unternehmen, die mit 30 Prozent den gröĂten Anteil ha-ben, vor den Banken und Versicherungen mit 23 Prozent, den Privathaushalten mit 17,5 Prozent und den Pensions- und Invest-mentfonds mit zusammen nur 14 Prozent.
Der groĂe Anteil der amerikanischen Pensions- und Investmentfonds am dorti-gen Aktienbesitz (mehr als 40 Prozent) si-chert ihnen EinfluĂ nicht nur auf die MĂ€rk-te, sondern auch auf die GeschĂ€ftspolitik der Unternehmen. Die Manager der gro-Ăen Fonds waren und sind es, die das Den-ken in den Kategorien des âShareholder value", des Unternehmenswertes und der Er-tragskraft, vorangetrieben haben. DaĂ sie ihre Macht gegenĂŒber den VorstĂ€nden aus-spielen, speziell informiert und gehĂ€tschelt werden wollen, gehört zum festen Bestand der Berichte und zum klagenden Tenor der Betroffenen. Da die AktionĂ€re im KalkĂŒl der VorstĂ€nde ĂŒber Jahrzehnte (ausgenom-men die GroĂaktionĂ€re) nur eine milde be-lĂ€chelte Rolle gespielt haben, hĂ€lt sich das Mitleid mit den angeblich so BedrĂ€ngten in Grenzen. Nicht alles, was behauptet wird, ist zum Nennwert zu nehmen. Die Macht selbst der GroĂen in der neuen âFinanzin-dustrie" relativiert sich ein wenig mit der wachsenden Zahl von Fonds und der Zu-nahme des Wettbewerbs unter ihnen. Aber Macht ist unzweifelhaft vorhanden.
In Baisseperioden tragen die Fonds zur Beruhigung der MĂ€rkte bei
Hier interessiert vor allem, daĂ die gro-Ăen amerikanischen Pensionsfonds - priva-te wie staatliche - rund zwei Drittel ihres Gesamtvermögens in Aktien und Aktien-fonds halten und nur kleinere Anteile zwi-schen 14 Prozent (private) und 24 Prozent (staatliche) in Rententiteln. Die Aktienquo-te hatte 1994 noch bei 50 Prozent gelegen;
der Zuwachs ist auch auf die starken Kurs-gewinne in der Zwischenzeit zurĂŒckzufĂŒh-ren, die das Gewicht der Aktien im Vermö-gensbestand vergröĂert haben.
Wie auch immer: Welcher Vermögens- -oder gar Pensionsfondsverwalter (Alterssi-cherung!) hĂ€tte hierzulande den Mut, zwei Drittel seines Portefeuilles in Aktien anzu-legen? Das ist Amerika, wie es in seiner Ri-sikobereitschaft leibt und lebt. Die beiden Pensionsfondsgruppen verwalteten Mitte vergangenen Jahres ein Gesamtvermögen von nicht weniger als 8 Billionen Dollar, das entspricht dem mehr als Vierfachen des deutschen Bruttoinlandsprodukts 2000. Der gesamte Altersversorgungsmarkt in den Vereinigten Staaten wird gar auf 12 Bil-lionen Dollar geschĂ€tzt. Die Investment-fonds nehmen fĂŒr sich in Anspruch, daran heute mit einem Drittel beteiligt zu sein (ge-speist auch aus den Pensionsfonds).
Es versteht sich von selbst, daĂ beide In-vestorengruppen nicht zur Panik neigen, auch wenn die Aktienkurse einmal stĂ€rker fallen. Im Gegenteil stellen sie mit ihrem hohen Marktgewicht einen ruhenden Pol im Auf und Ab des Börsengeschehens dar - im Gegensatz zu den unseligen Invest-menttrusts der zwanziger Jahre, die in der Krise vermöge ihrer dubiosen Struktur und Hebelmechanik mit doppelter Wucht ins Bodenlose stĂŒrzten und danach von der BildflĂ€che verschwanden, Hunderttausen-de geprellter Anleger zurĂŒcklassend. Stabilisierend wirken ĂŒberdies die lau-fend eingehenden Beitragszahlungen bei den Pensionsfonds und - soweit SparvertrĂ€-ge vorliegen - auch bei den Investment-fonds, die alsbald angelegt werden mĂŒssen. Die Fondsmanager verweisen zudem auf den steigenden Anteil von Erbvermögen, die hĂ€ufig âeinfach liegengelassen werden", wie immer die Marktlage beschaffen sei. Wenn vorsichtige Anleger, wie im vergange-nen Jahr verstĂ€rkt zu beobachten, in SchwĂ€-cheperioden in Dachfonds umsteigen, dann bleiben die Gelder doch im System und ver-stĂ€rken die Baisse nicht zusĂ€tzlich.
Die Fonds schĂŒtzen nicht davor, daĂ es zu Blasenbildungen am Aktienmarkt kom-men kann. Der Performancedruck im Wett-bewerb zwingt sie, Gelder auch dann noch in den Neuen Markt oder nach SĂŒdostasien zu pumpen, wenn absehbar ist, daĂ dort Ăberdruck herrscht. Allenfalls können sie ihre liquiden Positionen eine Zeitlang stĂ€r-ken, aber auch das hat seine Grenzen. Ro-land Leuschel, ein belgischer Fondsmana-ger der alten Schule, beschreibt das Dilem-ma: Der Anleger verzeihe am Ende jeden Crash, aber nie den vorbeugenden Aufbau von liquiden, renditearmen Positionen in ei-ner Hausseperiode, selbst wenn deren Bla-sencharakter mit HĂ€nden zu greifen sei. Da hat er wohl recht. Bei den groĂen Pensions-fonds allerdings dĂŒrfte dieser spezifische Performancedruck wegen des langfristigen Charakters der Anlagen geringer sein.
Das Fazit lautet gleichwohl, daĂ die Fonds mit ihrer Risikostreuung, ihrem Marktgewicht und ihrem inneren Behar-rungsvermögen auch in kritischen Zeiten zunĂ€chst zur Beruhigung der eigenen Anle-ger, die ĂŒberdies immer erfahrener werden, im weiteren aber auch zur allgemeinen Be-ruhigung der MĂ€rkte zumindest in den Bais-sephasen beitragen, indem sie durchhalten. Je weiter die Altersversorgung auf privater Grundlage und mit Hilfe von Fonds fort-schreitet, desto stĂ€rker wird sich dieser Ef-fekt auch in Europa bemerkbar machen.
Gleichwohl sollte sich auch unter diesen gĂŒnstigen Auspizien niemand ermutigt fĂŒh-len, blind in die MĂ€rkte einzusteigen und je-dem Boom nachzulaufen. Nur wer sein Ver-mögen angemessen streut, fĂŒr ausreichen-de Anlagefristen und genĂŒgend LiquiditĂ€t fĂŒr die WechselfĂ€lle des Lebens sorgt, kann die unvermeidlichen Abschwungsperioden der MĂ€rkte gelassen durchstehen. Auch eine Rezession ist nie auszuschlieĂen.
AuszuschlieĂen ist nur, daĂ die Rezessi-on zur Depression mutiert und in eine wirt-schaftliche Katastrophe wie 1929 mĂŒndet. Solche Schreckensszenarien verhindern zu können, darf die Nationalökonomie heute fĂŒr sich in Anspruch nehmen, und die Poli-tik wĂŒrde das notwendige Instrumentarium gegebenenfalls auch anwenden. DaĂ die Katastrophe von 1929/33 sich in sieben Jahr-zehnten nicht wiederholt hat, war durchaus kein Wunder, wie Galbraith einst meinte. Es war die Folge von vielen grundlegenden VerĂ€nderungen im Datenkranz von Institu-tionen, Gesetzen, Regelmechanismen und Transparenzgeboten. Die Welt hat sich wirt-schaftlich zivilisiert, auch wenn die Sehn-sucht nach dem schnellen Reichtum mĂ€ch-tig geblieben ist - oder richtiger vielleicht:
weil sie mÀchtig geblieben ist.
<center>
<HR>
</center> |
 Thread-Ansicht
Thread-Ansicht Mix-Ansicht
Mix-Ansicht