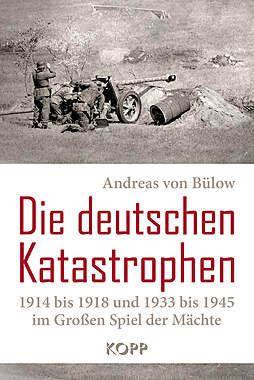-->"Noch vor einem Jahr hatte Muhammad Spielkarten mit der Aufschrift"Nennt mich Gott" verteilt. Er hatte ein Land in seinem Griff, er war der Sniper von Washington, ein Scharfsch√ľtze, der √ľber Leben und Tod entschied."
Das muss den SPIEGEL nat√ľrlich ungemein wurmen! Allwissend und daher Gott gleich ist schlie√ülich nur dieses Rotz-Blatt. Schlie√ülich wei√ü es obigen Satz als FAKTUM zu berichten, nicht etwa nur als MUTMASSUNG.
Unerwähnt lässt der SPIEGEL - wie von der Systempresse auch nicht anders zu erwarten -, dass
(a) wochenlang nach einem weißen Van gefahndet worden war, den etliche Augenzeugen in jeweiliger Tatortnähe gesehen hatten.
(b) der der blaue Chevrolet Caprice DAS Standardfahrzeug desw FBI f√ľr zivile Undercover-Aktionen war.
(c) Muhammad zwar mal tatsächlich eine Bushmaster besessen hatte, diese jedoch lange vor den Attentaten wieder verkaugt hatte.
(d) das angebliche T√§terprofil besonders gut zur rassistisch-religi√∂sen Hetze tauge. Ist doch der angebliche (Haupt-)T√§ter Muhammad ein Schwarzer und Moslem. Wie passend f√ľr Kriegsl√ľstlinge im Umfeld der US-Administration.
(e) die Massenpanik unmittelbar vor den Kongresswahlen nur einem n√ľtzte: G.W. Bush (und seinen republikansichen Freunden). Das verprach reichlich innenpolitische Unterst√ľtzung im"Kampf gegen den Terror" sowie im Grundrechtekahlschlag √ľbelsten Ausma√ües! Und so kam es denn ja auch.
Abgesehen davon ist der Artikel dennoch lesenswert!
RK
DER SPIEGEL 45/2003 - 03. November 2003
URL: http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,273019,00.html
Im Anzug zum Schafott
Zusammen mit einem Freund soll John Muhammad vor einem Jahr zehn Menschen aus dem Hinterhalt erschossen haben - als Sniper von Washington, als Herr √ľber Leben und Tod. Nun wird ihm im US-Bundesstaat Virginia der Prozess gemacht. Von Alexander Osang
Als John Allan Muhammad an seinem ersten Verhandlungstag nach vorn zum Richtertisch ging, war er eigentlich bereits ein toter Mann. Ein toter Mann in einem graubraunen Jackett, schwarzen Hosen und billigen Schuhen, die ihm von amerikanischen Regierungsbeh√∂rden gestellt worden waren, damit er am Ende anst√§ndig aussieht. Ein toter Mann, der von zwei Starverteidigern begleitet wurde, f√ľr die seine ausweglose Lage nur eine juristische Herausforderung ist. Ein Hauch von einem Lebewesen. Ein Geist.
Noch vor einem Jahr hatte Muhammad Spielkarten mit der Aufschrift"Nennt mich Gott" verteilt. Er hatte ein Land in seinem Griff, er war der Sniper von Washington, ein Scharfsch√ľtze, der √ľber Leben und Tod entschied. Jetzt schien es, als habe ihn jede Macht verlassen.
Es war ein sonniger Herbsttag in Virginia, einem Bundesstaat, in dem nach Texas die meisten Todesurteile Amerikas vollstreckt werden. D√ľsenj√§ger der nahe gelegenen Navy-Base flogen ihre √úbungen am hellblauen Atlantikhimmel. Dutzende amerikanische Fernsehreporter warteten mit frisch gemischten Betonfrisuren in der Morgensonne auf ihre ersten Live-Schaltungen. Drinnen im Gerichtssaal dr√ľckten die Staatsanw√§lte ihre R√ľcken durch. Chef der Anklage war Paul Ebert, der schon zw√∂lf M√∂rder zur Todesstrafe gef√ľhrt hat, so viel wie kein anderer Staatsanwalt in Virginia. Sein Stellvertreter James Willett hat es auch schon auf sechs Todesurteile gebracht. Die Staranw√§lte Jonathan Shapiro und Peter Greenspun haben Muhammads Verteidigung √ľbernommen, aber die meisten fragten sich, was hier √ľberhaupt noch verteidigt werden sollte. Vor zwei Tagen war auf dem Sender USA der erste Fernsehfilm √ľber die Sniper gezeigt worden. Millionen Fernsehzuschauer hatten sie morden sehen. Sie waren Geschichte.
Leise richtet John Allan Muhammad seine ersten Worte an den Richter LeRoy Millette."Kann ich mich selbst verteidigen, Sir?"
"Warum wollen Sie das tun?", fragt Richter Millette.
"Weil ich glaube, dass ich am besten f√ľr mich sprechen kann", sagt Muhammad.
"Sagen Sie mir, warum Sie das können."
"Weil ich mich kenne."
Das ist ein Argument. John Muhammad hat ein r√§tselhaftes Leben gef√ľhrt. Er ist 42 Jahre alt, er diente 17 Jahre lang der amerikanischen Nationalgarde und der U. S. Army, f√ľr die er auch im ersten Golfkrieg war. Er konvertierte zum Islam, er war zweimal verheiratet, er hat f√ľnf Kinder. Aber als man ihn verhaftete, lebte er in einem verm√ľllten Chevrolet Caprice, zusammen mit einem 17-j√§hrigen jamaikanischen Jungen namens Lee Malvo, den er
seinen Sohn nannte. Im R√ľcksitz ihres Wagens war das Gewehr versteckt, mit dem mindestens acht Leute erschossen worden waren. Viele, die sich an Muhammad erinnern, sagen heute, er sei immer ein bisschen verr√ľckt gewesen. Aber gekannt hat ihn zum Schluss wohl niemand mehr.
Richter Millette stimmt Muhammads Antrag zu. Er darf sich selbst verteidigen. Shapiro und Greenspun sind entlassen. John Allan Muhammad ist jetzt ganz allein. Er hat nur noch den geliehenen Anzug.
Ein Gerichtsdiener bringt eine l√§ngliche Stofftasche zur Anklagebank. Staatsanwalt James Willett √∂ffnet sie und entnimmt ihr eine Bushmaster XM-15 E2S, das Sniper-Gewehr. Er baut es auf, das Metall klackt k√ľhl, als er den St√§nder ausklappt, er richtet den Lauf der Waffe so aus, dass sie die Geschworenenbank nur um eine Handbreit verfehlen w√ľrde. So l√§sst er sie stehen w√§hrend seines Er√∂ffnungspl√§doyers.
Willett versucht die Schreckenszeit des vergangenen Jahres zur√ľckzuholen, als Menschen an Tankstellen und auf Parkpl√§tzen herumzappelten, um ein schlechtes Ziel abzugeben. Wenn sie √ľberhaupt noch aus dem Haus gingen. Die Waffe auf dem Tisch h√§tte in jenen drei Wochen jeden treffen k√∂nnen. Die Sniper bewegten sich geschmeidig durch das dichte Schnellstra√üennetz. Sie schossen und verschwanden in der Anonymit√§t immergleicher Landschaften aus Parkpl√§tzen, Zufahrten, Tankstellen, Superm√§rkten, Drive-In-Restaurants. Alles floss, und sie schwammen mit. Der letzte Blick ihrer Opfer fiel auf den Preis f√ľr Normalbenzin an der Leuchtreklame einer Esso-Tankstelle, auf die Werbung f√ľr ein Fr√ľhst√ľck bei McDonald's oder auf die √úbernachtungskosten f√ľr ein Doppelbett in einem Days Inn.
"Die Sniper reisten, wohin sie wollten, sie parkten, wo sie wollten, sie töteten, wen sie wollten. Die Welt um sie herum wurde zum Feindesland, und je mehr sie töteten, desto größer wurde es", sagt Willett.
Er z√§hlt die Opfer auf, redet von Blut, Schmerzen, Trauer und Verzweiflung. Er zeigt Lichtbilder des blauen Chevrolet Caprice, aus dessen Kofferraum die t√∂dlichen Sch√ľsse abgegeben wurden. Der Staatsanwalt k√ľndigt Hunderte Zeugen an, Fingerabdr√ľcke, Tonb√§nder und Experten, die belegen werden, dass John Muhammad der Kopf dieser"terroristischen Aktion" war. Willett, ein Triathlet, umkreist die Waffe, er zeigt immer wieder auf Muhammad, aber der macht sich Notizen f√ľr seine eigene Rede, die ihn weit wegf√ľhren wird von all den schmutzigen Details, die der Staatsanwalt eine Stunde lang auflistet.
Nachdem Willett das Gewehr wieder verpackt hat, erhebt sich John Muhammad, um sein Eröffnungsplädoyer zu halten. Er geht ruhig nach vorn.
"Guten Abend", sagt John Muhammad und sieht die Geschworenen an.
"Wir werden von diesem Gericht aufgefordert, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. Ich versteh das nicht ganz. Ich dachte eigentlich immer, es gibt nur die eine Wahrheit. Jesus sagt: 'Du sollst die Wahrheit sagen!' Er sagt nichts von der 'ganzen Wahrheit' und nichts von 'nichts als der Wahrheit'."
Verteidiger Shapiro beginnt, sich die Schl√§fen zu massieren, die Staatsanw√§lte tuscheln, aber Richter Millette sieht Muhammad interessiert an, der jetzt zu einer l√§ngeren Geschichte ausholt. Vor ein paar Jahren habe er seine Lieblingstochter Taliba gebeten, keine Schokoladenkekse aus der Keksb√ľchse zu nehmen, als er das Haus verlie√ü. Aber als er wieder zur√ľckkam, traf er sie im Garten mit einem Keks in der Hand. Als sie ihm das erkl√§ren wollte, verbot er ihr den Mund und schickte sie in ihr Kinderzimmer, wo sie weinend zusammenbrach. Wenig sp√§ter erz√§hlte ihm sein Sohn, dass er ihr die Kekse aus dem Laden mitgebracht habe und sie sogar den Rest in die Keksb√ľchse gelegt habe.
"Ich habe mich auf das verlassen, was ich sah. Aber ich wusste nicht, was tatsächlich passiert ist. Und ich sage zu diesen Leuten", Muhammad zeigt auf die Staatsanwälte,"wir wissen, dass etwas passiert ist. Aber sie waren nicht dabei. Ich war da. Ich weiß, was passiert ist, und ich weiß, was nicht passiert ist. Alles, was sie mit mir gemacht haben, alles, was sie sagen, basiert auf einer Theorie. Eine Theorie. Ich wurde auf Grund einer Theorie eingesperrt. Mir wurde die Kaution verweigert, auf Grund einer Theorie. Was ist eine Theorie? Eine Vermutung, denke ich. Eine Annahme. Eine Theorie ist keine Tatsache."
Muhammad erz√§hlt von einem schmutzigen und einem sauberen Glas, zwischen denen sich die Geschworenen entscheiden m√ľssen. Am Ende sagt er:"Lassen Sie sich nicht von Gef√ľhlen in Ihrer Entscheidung leiten, auch nicht von Gef√ľhlen, von denen Sie annehmen oder hoffen, dass sie richtig sind. Mein Leben und das meines Sohnes stehen auf dem Spiel. Seien Sie aufmerksam. Wenn wir genau hinschauen, wenn wir aufmerksam zuh√∂ren, werden die Beweise St√ľck f√ľr St√ľck zeigen, dass ich nichts mit diesen Straftaten zu tun habe. Ich habe nichts damit zu tun."
Es ist ein erstaunlicher Auftritt. Eine Rede wie auf dem Schafott oder in einem amerikanischen Gerichtssaal-Spielfilm. Es herrscht eine ungl√§ubige, and√§chtige Stimmung. F√ľr einen Moment rechnet man fast mit Beifall, aber es bleibt still. Muhammad hat sich mit seinen Worten in den winzigen Freir√§umen hin und her bewegt, die er noch hat. Weit weg von all dem Blut und den Fingerabdr√ľcken ist er in eine Welt h√∂herer Gerechtigkeit vorgedrungen.
John Muhammad ist wieder am Leben. Er l√§uft mit ruhigen Schritten zur√ľck zu seiner Bank und setzt sich. Die Journalisten haben Erregungsflecken im Gesicht. Drau√üen auf den Parkpl√§tzen berichten die Reporter mit den Betonfrisuren das Ungeheuerliche. In den Zeitungsredaktionen werden die Titelseiten freiger√§umt.
Der erste Zeuge der Anklage ist Mark Spicer, Sergeant Major der britischen Armee, ein professioneller Sniper, der auf der ganzen Welt im Einsatz war.
Spicer erzählt, dass Sniper immer in Zweimannteams arbeiten. Ein Mann beobachte, sichere die Gegend und wähle die Ziele aus. Der andere schießt.
"Wer ist der wichtigere Mann?", fragt Staatsanwalt Ebert.
"Der, der die Ziele auswählt", sagt Sergeant Major Spicer.
Die Staatsanwaltschaft zeigt ihm Dinge, die sie im Caprice fand. Ein Navigationsgerät, Walkie-Talkies, Karten, ein Diktiergerät und schließlich das Gewehr. Spicer sagt, dass all diese Dinge zur Grundausstattung eines Sniper-Teams gehören.
"Was ist das Ziel eines Snipers?", fragt Ebert.
"Sniper richten mit kleinstem Aufwand so viel Schaden wie m√∂glich an. Sie greifen nicht an der Front an, sondern im Hinterland. Sie suchen sich weiche Ziele, sie attackieren den Unterleib. Du t√∂test den Fahrer des Tanklasters zum Beispiel. Oder den Funker. Erschie√ü einen Funker, erschie√ü den n√§chsten Funker und dann noch einen, und du wirst sehen, dass niemand mehr ans Funkger√§t will. Sniper zerst√∂ren das Vertrauen zwischen unteren R√§ngen und dem Kommando. Es entsteht eine Atmosph√§re der absoluten Unsicherheit. Und je mehr und je willk√ľrlicher man Leute erschie√üt, desto gr√∂√üer ist die Unsicherheit. Wenn du den Feind nicht siehst, kannst du ihn auch nicht stoppen."
Sergeant Major Spicer hat ein Buch dar√ľber geschrieben. Es klingt, als h√§tten es die Sniper von Washington gelesen.
Sie erschossen vier Menschen an einem Vormittag in ein und derselben Gegend in Maryland, zwei M√§nner und zwei Frauen, sie waren zwischen 25 und 54 Jahre alt. Dann warteten sie zw√∂lf Stunden, t√∂teten einen 72j√§hrigen Rentner in Washington D. C. Am n√§chsten Tag schossen sie auf eine Frau in Virginia, drei Tage sp√§ter auf einen 13-j√§hrigen Schuljungen in Maryland. Es gab kein Muster, keine Motive, keine Spuren. Sie schossen willk√ľrlich in den weichen Unterleib Amerikas. Schon nach zwei Wochen erreichten sie damit den Pr√§sidenten."Es ist unertr√§glich, dass M√ľtter sich nicht mehr trauen, ihre Kinder zur Schule zu bringen", sagte Pr√§sident Bush im Oktober 2002."Das ist nicht das Amerika, das ich kenne."
"Guten Tag", sagt John Muhammad nun, im Oktober 2003, als er das erste Kreuzverhör seines Lebens beginnt.
"Hallo", sagt der Sergeant Major k√ľhl.
"Waren Sie jemals in einer amerikanischen Mall?", fragt Muhammad.
"Ja", sagt Spicer.
"Kann einem da nicht so ein Walkie-Talkie gute Dienste leisten?" Er hält das Gerät in die Höhe, das man in seinem Wagen gefunden hat.
"Sicher", sagt der Sergeant Major.
"Ist es nicht so, dass fast all die Gegenst√§nde, die eben gezeigt wurden, auch f√ľr zivile Zwecke genutzt werden k√∂nnen?"
"Ja."
Muhammad nimmt das Gewehr in die Hand. Er schaut es nachdenklich an.
"Haben Sie mich jemals mit dieser Waffe schießen sehen?", fragt er.
"Nein."
"Haben Sie mich √ľberhaupt jemals zuvor gesehen?"
"Nein."
"Haben Sie den Fall im vorigen Jahr verfolgt?"
"Nur in den Medien. Ich war zu der Zeit im Kosovo", sagt Spicer.
"Danke", sagt Muhammad und geht zu seinem Platz zur√ľck.
Spicer sitzt ratlos in der Zeugenbank. Er ist ein Offizier, der von der Queen f√ľr seine Dienste ausgezeichnet wurde. Er ist vor zweieinhalb Wochen von der Staatsanwaltschaft zu diesem Prozess eingeladen worden. Er hat eine dicke Mappe mit Unterlagen dabei und eine Kiste mit Dias. Aber auf diese Begegnung war er nicht vorbereitet. Er verl√§sst mit steifen Schritten den Saal. Drau√üen wartet schon Larry Meyers, dessen Bruder Dean Meyers am 9. Oktober 2003 an einer Sunoco-Tankstelle in Manassass erschossen wurde.
Meyers Ermordung ist der Präzedenzfall der Anklage. An ihm wollen sie Muhammads Schuld exemplarisch beweisen. Meyers war in Virginia erschossen worden, in Staatsanwalt Paul Eberts eigenem County. Und Meyers war ein Vietnam-Held.
Sein Bruder Larry nimmt im Zeugenstand Platz und erz√§hlt aus dem Leben des Toten. Dean Meyers wurde in Vietnam verwundet, er wurde ausgezeichnet. Als er zur√ľckkam, studierte er Maschinenbau, fing in Washington an zu arbeiten und kaufte sich ein St√ľck Land, auf dem er ein Haus baute. Er rauchte nicht, trank nicht und benutzte keine Kraftausdr√ľcke. Die Staatsanwaltschaft wirft ein Foto des Vietnam-K√§mpfers auf die Leinwand, dann eins aus dem vorigen Sommer, das einen freundlich l√§chelnden 50-j√§hrigen Mann mit Schnurrbart zeigt, und schlie√ülich das Foto des erschossenen Meyers, der neben der Tanks√§ule 4 der Sunoco-Station liegt. Aus seinem Kopf ergie√üt sich eine Blutlache, neben ihm liegt die Kreditkarte, mit der er seine Tankf√ľllung bezahlte.
"Ist das Ihr Bruder im Tod?", fragt Ebert.
"Ja", sagt Meyers.
Das letzte Foto zeigt Meyers auf dem Obduktionstisch. Eine Gerichtsmedizinerin weist auf die t√∂dliche Wunde, aber auch auf die Narben, die sich Meyers in Vietnam holte. In diesem Moment steht der tote Dean Meyers f√ľr Amerika. Ein aufrechter Mann, ein Vietnam-Held, der hinterr√ľcks erschossen wurde. Es ist eine moralische Auseinandersetzung. Die Sniper haben Amerika angegriffen. Das macht sie zu Terroristen, √§hnlich denen, die das World Trade Center angriffen.
Muhammad hat keine Fragen an den Hinterbliebenen.
Linda Thompson, die in der Bank nahe der Tankstelle arbeitet, hat die Sniper in der Mordnacht gesehen, sagt sie. Ihr sei am Abend ein blauer Chevrolet aufgefallen, der auf dem Parkplatz vor ihrer Bank wartete. Zwei schwarze M√§nner h√§tten sich neben dem Wagen aufgehalten. Einer sei Muhammad gewesen, der zweite war j√ľnger, sagt sie. Der Staatsanwalt fragt, ob sie ihn identifizieren k√∂nne. Sie nickt.
Eine Minute sp√§ter wird Lee Malvo in den Gerichtssaal gef√ľhrt. Er ist in Ketten gelegt und steckt in einem orangefarbenen H√§ftlingsoverall. Sein Prozess beginnt am 10. November in einem Gerichtssaal in der N√§he. Er schaut wie ein gehetztes Tier.
Linda Thompson identifiziert Malvo als den zweiten Mann. Der Junge achtet nicht auf die alte Frau, er schaut die ganze Zeit zu Muhammad, seinem"Vater", der dort in einem Anzug und mit Krawatte auf der Verteidigungsbank sitzt wie ein Anwalt. Muhammad schaut nicht zur√ľck. Malvo hat in den Tagen nach seiner Verhaftung einem Ermittler vom Verh√§ltnis zu Muhammad erz√§hlt. Er k√∂nne die Energie seines Freundes sp√ľren, wenn er in der N√§he sei. Sie w√ľrden einander besch√ľtzen. Er sagte, dass der Schuss auf Dean Meyers ausgezeichnet gewesen sei. Ein Kopfschuss, den sie weit weg von den bisherigen Anschl√§gen ausf√ľhrten, um die Polizeikr√§fte auszud√ľnnen. Malvo sagte auch, dass sie sich mit dem Schie√üen abwechselten, blieb aber sehr vage, was die Rolle von Muhammad anging. Der sei meist gefahren.
Malvo verrenkt sich den Kopf, um einen Blick von Muhammad zu erhaschen, seine Energie zu sp√ľren, w√§hrend ihn die W√§rter abf√ľhren. Muhammad schaut erst auf, als er aus dem Saal ist.
Einen ganzen Tag lang umkreist die Staatsanwaltschaft den Mord an Dean Meyers. Sie werfen Luftbilder an die Leinwand, die √ľberall in Amerika aufgenommen worden sein k√∂nnten. Tankstellen, Motels, Schnellrestaurants, eine Interstate, diesmal ist es die I-66. Der Schuss, der Dean Meyers t√∂tete, ist vom Parkplatz des Bob-Evans-Restaurants abgegeben worden, das gegen√ľber der Sunoco-Tankstelle liegt. Man fand eine Stra√üenkarte mit Malvos und Muhammads Fingerabdr√ľcken auf dem Parkplatz.
Policeofficer Steven Bailey sagt aus, dass er den blauen Chevrolet etwa eine Stunde nach dem Mord kontrollierte, als er den Parkplatz vom Bob-Evans-Restaurant verlassen wollte. Er identifiziert Muhammad als den Fahrer. Bailey habe ihn gefragt, was er hier mache. Muhammad habe ihm gesagt, dass er gerade aus dem Florida-Urlaub komme, er sei von der Polizei auf diesen Parkplatz geschickt worden, weil die Interstate gesperrt worden sei. Muhammad sei sehr freundlich und kooperativ gewesen, sagt der Polizist. Daraufhin habe er ihn passieren lassen.
Er ist √ľbergewichtig, wie die meisten Polizisten, die aussagen. Ihre Uniformhemden spannen √ľber dem Bauch, sie k√∂nnen vor Kraft kaum laufen. Ein Officer beschreibt sp√§ter, wie ihm Malvo, den er nach einem Mord in Louisiana stoppte, einfach weglief."Er kam besser √ľber den Zaun als ich", sagt der Mann und l√§chelt verlegen. Neunmal ist der blaue Chevrolet Caprice in den drei Sniper-Wochen von der Polizei gestoppt worden. Jedes Mal haben sie ihn wieder fahren lassen. Der Wagen war ordnungsgem√§√ü zugelassen. Steven Bailey ist seit zwei Jahren im Dienst und voll guten Willens. Sechs Stunden lang hat er den Parkplatz noch bewacht, nachdem der blaue Chevrolet abgefahren war. Er wusste ja nicht, dass sie es waren. Er hat seine Beobachtung erst gemeldet, als die Sniper gefasst und die Bilder von Muhammad und Malvo in allen Zeitungen zu sehen waren.
"Wieso erinnern Sie sich an mich?", fragt Muhammad den Zeugen.
"Sie waren der einzige schwarze Fahrer auf dem Parkplatz", sagt der Polizist.
John Muhammad lächelt. Er wirkt in diesem Moment nicht wie ein Massenmörder. Er wirkt wie Sidney Poitier in"In der Hitze der Nacht". Ein schlanker, gut formulierender, schwarzer Mann zwischen dicken, weißen Polizisten. Er ist noch einmal stark. Man könnte sich vorstellen, dass er von Denzel Washington gespielt wird, wenn der Sniper-Fall ins Kino kommt.
Kurz bevor der zweite Verhandlungstag zu Ende geht, gibt der Richter zu Protokoll, dass Muhammad als sein eigener Anwalt eine sehr gute Figur abgibt. Er scheine zu wissen, was er tue. Am n√§chsten Morgen tritt Muhammad vor den Richtertisch und sagt, er m√∂chte, dass ihn ab jetzt wieder seine Anw√§lte vertreten. Er nennt keine Gr√ľnde, vielleicht wei√ü er nicht weiter, vielleicht hat er erreicht, was er wollte.
Er kennt sich selbst am besten.
Seine Anw√§lte Shapiro und Greenspun springen von der Kette. Ihr erstes Opfer ist der Autoh√§ndler aus New Jersey, der Muhammad im September den gebrauchten Chevrolet Caprice verkaufte. Es war ein ausrangierter ehemaliger Undercover-Einsatzwagen der Polizei. Er stand schon √ľber ein Jahr auf dem Hof. Sie mussten den Wagen anschieben, weil er nicht ansprang. Sie haben 250 Dollar daf√ľr bezahlt.
"Ich bin nicht besonders stolz auf das Auto, aber sie wollten ihn unbedingt", sagt der H√§ndler. Greenspun verwickelt ihn in immer mehr Widerspr√ľche, am Ende scheint der Mann froh zu sein, dass sie ihn nicht gleich dabehalten. Muhammad versinkt wieder auf der Bank. Die Gerichtsmaschine l√§uft jetzt wie geschmiert.
Die Verhandlung ist nun im S√ľden angekommen. An der Interstate 95. Es gibt ein Luftbild mit einem Days Inn, einem Hardee's und einem McDonald's. Muhammads Anw√§lte bringen Zeugen aus Louisiana dazu, sich gegenseitig zu widersprechen. Ein Mann glaubt, Malvo habe ein olivfarbenes T-Shirt getragen, eine Frau sagt, es sei ein wei√ües Unterhemd gewesen; der Mann erinnert sich an ein wei√ües Baseballcap, die Frau nicht. Es sind Kleinigkeiten, Ungenauigkeiten der Zeugen, Spitzfindigkeiten der Gerichtsmaschine.
Von schmutzigen und sauberen Gläsern ist nicht mehr die Rede. Auch nicht vom Unterschied zwischen Wahrheit und ganzer Wahrheit.
Die Tage fließen zäh vorbei. Richter Millette gähnt. Alles wiederholt sich. Niemand hat Muhammad schießen sehen. Immer wieder sehen Zeugen den Chevrolet wegfahren, parken, ankommen. Aber die Fotos der Opfer werden immer blutiger. Am Ende der ersten Woche ist das zerschossene Gesicht einer Frau aus Louisiana acht Minuten lang auf der Saalleinwand zu sehen. Die Staatsanwälte kriechen immer tiefer in die zerfetzten Organe der Toten, folgen den Geschosssplittern auf ihren Wegen durch Brustkörbe und Schädel.
In der zweiten Woche sagt der 14-j√§hrige Iran Brown aus, den sie in Maryland angeschossen haben. Das Tonband mit dem Polizeinotruf seiner Tante, die ihn an diesem Tag zur Schule brachte, wird abgespielt. Man h√∂rt den Jungen im Hintergrund wimmern. Sie mussten ihm die Milz und einen Teil der Leber entfernen, er hat Gl√ľck gehabt.
"Das Ungl√ľck hat mich Gott n√§her gebracht", sagt der Junge im Zeugenstand.
Seine Tante bricht in Tränen aus. Die Geschworenen sind beeindruckt.
Muhammad ist nicht zu retten.
Staatsanwalt Ebert steht kurz vor der Pensionierung. Er ist ein passionierter J√§ger, er wird keine Ruhe geben. Shapiro und Greenspun wissen das. Sie dr√§ngen auf ein psychologisches Gutachten ihres Klienten. Auch Lee Malvos Anw√§lte haben in der vorigen Woche erkl√§rt, dass ihr Mandant w√§hrend der Sniper-Attacken nicht zurechnungsf√§hig war. Die Sniper k√∂nnen nur noch als Geistesgest√∂rte √ľberleben.
Man wird Gr√ľnde finden, wenn man will. Man sp√ľrt, dass John Muhammad auch ein professioneller Sniper h√§tte werden k√∂nnen wie der britische Sergeant Major Spicer. Muhammads Vater verschwand gleich nach der Geburt, seine Mutter starb, als er drei Jahre alt war. Er hatte Disziplinschwierigkeiten bei der Armee. Seine erste Frau nannte ihn einen militaristischen Kontrollfreak. Am schlimmsten traf ihn wohl, dass ihm seine zweite Frau die Kinder entziehen lie√ü. Bei seiner ersten und einzigen polizeilichen Vernehmung in der Nacht, in der er verhaftet wurde, sagte er, seine Probleme fingen an, weil seine Frau ihn betrogen habe.
Vielleicht war es kein Zufall, dass die meisten Opfer in der unmittelbaren Nachbarschaft seiner Ex-Frau im Montgomery County von Maryland erschossen wurden. Malvo allerdings hat bei seinem Verhör erzählt, sie wollten die"reichen Leute" des Montgomery County bestrafen. Er erklärte, wie sie die Gesellschaft schocken wollten, dass sie psychologisch vorgingen, wie in einer Schlacht. Sie sahen sich immer wieder die DVD von"We Were Soldiers" an, einem Vietnam-Kriegs-Epos mit Mel Gibson, sagte er. Malvo ist auch von Hannibal begeistert, dem punischen Feldherrn. Er hat Thomas Jefferson gelesen und die Schriften des Islam. Am meisten aber faszinierte ihn"Matrix", ein Film, in dem wenige menschliche Kämpfer die Herrschaft der Maschinen brechen wollen. Die virtuellen Gegner tragen Sonnenbrillen und sehen aus wie FBI-Beamte.
John Muhammad und Lee Malvo haben Amerika angegriffen. Der 11. September 2001 ersch√ľtterte die amerikanische Stadt, die drei Wochen im Oktober 2002 das amerikanische Land. Experten vermuteten damals, dass ein Terrornetzwerk hinter den Snipern stecke. Vielleicht hat auch deshalb lange niemand auf den sch√§bigen Chevrolet Caprice geachtet. Ein 250-Dollar-Auto aus New Jersey, das die Polizei einst ausrangiert hatte. Sie waren ohnm√§chtig, und sie werden sich f√ľr diese Ohnmacht r√§chen.
"Sie waren nicht dabei. Ich war da. Ich weiß, was passiert ist und was nicht passiert ist", hat John Muhammad in seinem Plädoyer gesagt.
Es ist das Einzige, was er ihnen noch voraus hat. Vielleicht bis in seinen Tod.
|
 Thread-Ansicht
Thread-Ansicht Mix-Ansicht
Mix-Ansicht