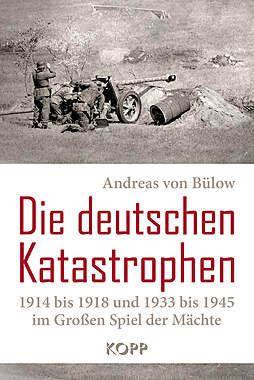-->Wie bloss soll ein deutscher SteuerflĂŒchtling sein Schwarzgeld auf die Schweizer Bank bringen?
http://www.facts.ch/dyn/magazin/wirtschaft/395714.html
Seid umschlungen, Milliarden
Wie bloss soll ein deutscher SteuerflĂŒchtling sein Schwarzgeld auf die Schweizer Bank bringen? Einfach mit dem Auto ĂŒber die Grenze fahren oder doch lieber das Flugzeug nehmen? WĂ€re es nicht das Beste, die Bank wĂŒrde das Geld gleich selber holen? Ein Test.
Claude Baumann, Andreas Juhnke, Klaus Werle, Daniel Ammann,
FĂŒr die Regierungen unserer NachbarlĂ€nder ist es das konstante Ărgernis: Der hohen Steuern ĂŒberdrĂŒssig, bringen ihre StaatsbĂŒrger immer hĂ€ufiger ihre Vermögen in die Schweiz. Heimlich. Allen voran die Deutschen. Mehr als 150 Milliarden Euro sind allein von deutschen Kunden auf hiesigen Depots gebunkert, schĂ€tzt der Chef der deutschen Steuergewerkschaft.
Und laufend werden es mehr. 2003 fing nur schon die deutsche Zollstelle in Singen zwei Milliarden Euro ab, die auf Banken in der Schweiz hĂ€tten versteckt werden sollen. Das ist die höchste Summe seit der EinfĂŒhrung von GeldwĂ€schereikontrollen 1998. Die Behörden sprechen von einer wahren «Geldschwemme» und sind nachhaltig verstimmt. Denn die Steueramnestie in Deutschland, die seit Anfang Jahr gilt, lĂ€uft weit gehend ins Leere. Finanzminister Hans Eichel, der sich gern verbalradikal gegen das Schweizer Bankgeheimnis geriert, rechnete mit Einnahmen von fĂŒnf Milliarden Euro - nur etwa 300 Millionen wurden bislang repatriiert. Jetzt hat seine Regierung den Schweizer Banken verboten, Privatkunden in Deutschland gezielt anzuwerben. KĂŒnftig brauchen sie fĂŒr grenzĂŒberschreitende GeschĂ€fte eine Bewilligung, schrieb der «Tages-Anzeiger» diese Woche.
Doch auch der jĂŒngste Schlag gegen das Bankgeheimnis wird kaum viele Deutsche vom illegalen Schwarzgeld-Tourismus abhalten können. Rechtslage und Risiko sind klar: Deutsche StaatsbĂŒrger mĂŒssen BetrĂ€ge von mehr als 15 000 Euro am GrenzĂŒbergang auf Anfrage anmelden. Wer dagegen verstösst, dem drohen hohe Bussen.
Bleibt die spannende Frage, wie das viele Schwarzgeld in den sicheren Hafen der Schweiz gelangt. FACTS machte die Probe aufs Exempel. Wir schickten drei deutsche StaatsbĂŒrger (ein Single und ein Paar) unter ihren echten Namen zu fĂŒnf Schweizer Banken: FĂŒr den Schwarzgeld-Test wĂ€hlten wir die Grossbanken Credit Suisse und UBS, die traditionsreiche Privatbank Julius BĂ€r, die aufstrebende Privatbank Swissfirst und die Schweizer Tochter der Deutschen Bank.
Das Szenario: Die Tester baten um Rat, wie man ein Vermögen von rund 1,5 Millionen Euro anlegt, wovon eine Million legal auf Wertschriften (Aktien, Obligationen) entfallen. 500'000 in bar allerdings, offenbarten sie den Bankberatern, seien nie versteuert worden. Das Schwarzgeld stamme aus Einnahmen des Vaters, der selbststĂ€ndiger Unternehmensberater gewesen sei. Welche Mittel und Wege gibt es, um dieses Vermögen in die Schweiz zu bringen und es «steueroptimal» anzulegen? Kann man die neue Zinssteuer umgehen? Sollen Deutsche von der Steueramnestie in ihrem Land Gebrauch machen? Und: Ist es ĂŒberhaupt möglich, einem seriösen Schweizer Banker mit solch suspekten Geschichten zu kommen?
Jedes Mal sind die potenziellen Kunden mit offenen Armen empfangen worden. Keine Bank war ĂŒberrascht, dass jemand mit Schwarzgeld kam. Vielmehr waren einige Banker durchaus bereit, das eine oder andere Risiko auf sich zu nehmen, um dem Kunden einen guten Dienst zu erweisen. Und alle Institute waren bereit, uns auch ganz kurzfristig einen Termin einzurĂ€umen («Wir sind ja keine Arztpraxis», Julius BĂ€r). «Mehr als 500000 Franken oder weniger?», fragt man beim Hauptsitz der Credit Suisse. «Mehr», lautet unsere Antwort.
«Dann verbinde ich Sie weiter.»
Credit Suisse
Keine 24 Stunden spĂ€ter sind wir am Hauptsitz der Credit Suisse am ZĂŒrcher Paradeplatz mit Herbert Monk* von der Abteilung Private Banking verabredet. Das nach der UBS zweitgrösste Finanzinstitut der Schweiz verwaltet Vermögen im Wert von 1200 Milliarden Franken. Vier Pforten mĂŒssen wir im GebĂ€udeinnern passieren, bis wir dem Kundenberater endlich die Hand schĂŒtteln können. Durch lange GĂ€nge fĂŒhrt er uns in ein Sitzungszimmer. Die Jalousie lĂ€sst nur Zwielicht herein. An den WĂ€nden hĂ€ngen abstrakte Reliefkunstwerke.
«Alles kein Problem», versichert Herr Monk. Will er damit allfÀllige Bedenken zerstreuen, dass wir hier etwas Unrechtes tun? Er redet schnell und gibt sich zupackend. Die Aktien und Obligationen seien unbedenklich, sagt Monk. «Die sind ja beim deutschen Finanzamt deklariert. Darum ist es auch kein Problem, diese auf ein Schweizer Konto zu transferieren.»
«Aber was geschieht mit dem unversteuerten Geld?», wollen wir wissen. Darum seien wir ja gekommen.
Herr Monk nickt verstÀndnisvoll. «Leider können wir Ihnen den Bargeldtransport nicht abnehmen. Das ist verboten.»
«Wirklich?», fragen wir.
FĂŒr einen Augenblick wirkt Herr Monk beinahe ein wenig traurig. Doch das trĂŒgt. Denn jetzt sagt er: «Beratung sollte immer auch Partnerschaft sein, und ein guter Partner weiss, was der andere will. Um das âčdiskrete Geldâș in die Schweiz zu bringen, empfehle ich Ihnen den Flieger - am besten die Air Berlin, Hamburg- ZĂŒrich fĂŒr 240 Franken das Ticket.» Er benĂŒtze ihn selber oft; etwa einmal im Monat, fĂŒr Kundenbesuche. «Nie Probleme gehabt», versichert Herr Monk. Bei der GepĂ€ckkontrolle wĂŒrden die Zöllner nur nach Sprengstoff suchen. «GeldbĂŒndel sehen die gar nicht.»
Banker Monk kennt noch eine elegantere Möglichkeit, um unser Geld in die Schweiz zu schleusen. Voraussetzung ist, dass wir eine weitere halbe Million flĂŒssig und legal zur VerfĂŒgung haben. «Also aufgepasst», empfiehlt er.
«Zuerst transferieren Sie ganz legal die in Deutschland deklarierten Aktien und Obligationen in die Schweiz. Sobald das geschehen ist», empfiehlt Herr Monk, möge man von einem anderen Konto in Deutschland die zweiten 500'000 Euro abheben. Der Bank in Deutschland könnten wir sagen, wir möchten damit ein Haus oder eine Segeljacht kaufen. «Dieses Geld legen Sie dann in ein Schliessfach in Deutschland», erklĂ€rt Herr Monk, «anschliessend bringen Sie Ihre âčdiskretenâș 500'000 Euro in die Schweiz.»
«Ja und was machen wir, wenn der Zoll das Geld entdeckt?», fragen wir.
«Das ist ja der Trick!», frohlockt der Schweizer Banker. «Sie zeigen den offiziellen Auszahlungsbeleg der Bank in Deutschland sowie die Bescheinigung fĂŒr das Konto bei uns, auf dem Sie bereits die Aktien und Obligationen haben. Dann erklĂ€ren Sie den Zollbeamten, das Geld werde offiziell in die Schweiz transferiert und versteuert.»
Wir nicken.
«Hier kommt dieses Geld natĂŒrlich auf ein separates Konto», prĂ€zisiert Herr Monk schmunzelnd. «Danach brauchen Sie nur noch das andere Geld wieder aus dem Schliessfach zu nehmen und es Ihrer Hausbank zurĂŒckzubringen. Dort sagen Sie: Die Villa hat mir leider nicht gefallen, oder die Jacht hatte ein Leck.»
Herr Monk ist kein Naivling, er weiss: «Wenn ein Deutscher mit einer grösseren Geldsumme in die Schweiz kommt, will er zwei Dinge. Erstens Diskretion, zweitens Steuern sparen.» Darum belĂ€stigt der Schweizer Finanzmann seine deutsche Klientel gar nicht erst mit langen ErklĂ€rungen und komplizierten Grafiken ĂŒber die Anlagestrategien seiner Bank. «Das machen wir ein andermal in Ruhe», sagt er. Jetzt ist Steueroptimierung angesagt. Herr Monk tippt mit dem Kugelschreiber auf seine Notizen und verkĂŒndet: «Wir machen einen Wrapper.»
«Wie bitte?», entgegnen wir.
Die AnlageertrĂ€ge, erfahren wir nun, fliessen bei einem «Wrapper» nicht direkt auf unser Konto, sondern zu einer Tochtergesellschaft im FĂŒrstentum Liechtenstein - steuerfrei versteht sich. Erst von dort gelangen die ErtrĂ€ge dann auf unser Konto, das quasi in die liechtensteinische Gesellschaft eingepackt (Englisch: to wrap) ist; steuerlich ist das im wahrsten Sinne des Wortes optimal. «Kein Problem also», sagt Herr Monk - mal wieder.
Nach einer guten Stunde verbleiben wir so, dass wir uns gegebenenfalls wieder melden. Wir wĂŒrden noch andere Angebote prĂŒfen. Ausser unseren wahren Namen hinterlassen wir keine anderen Angaben. Unser diskretes Auftreten scheint dem Banker nicht ungewöhnlich zu sein.
Swissfirst
Zwei voneinander unabhĂ€ngige Besuche fĂŒhren uns zur ZĂŒrcher Swissfirst Bank. In beiden FĂ€llen lĂ€uft das jeweilige Treffen mit unterschiedlichen Mitarbeitern sehr Ă€hnlich ab. Berater Frank Hofer tönt die Schwierigkeiten mit dem Geldtransport aus Deutschland gleich selber an: «Eine Ăberweisung können Sie gleich vergessen. Es geht ja um diskretes Geld. Manche Kunden haben mir erzĂ€hlt, dass sie nicht direkt in die Schweiz fahren, sondern einen Umweg ĂŒber Frankreich oder Ă-sterreich machen. Da sollen die Kontrollen weniger scharf sein.» Nie spricht er direkte Empfehlungen aus, lieber zitiert er Aussagen seiner Klientel. «Kunden haben mir berichtet, manche GrenzĂŒbergĂ€nge seien nachts unbewacht.»
Die Swissfirst Bank befindet sich im ZĂŒrcher Enge-Quartier, also ausserhalb der Innenstadt. Klar, zum Essen mĂŒsse man in die Stadt fahren, sagt Hofer, aber die Kunden schĂ€tzten die Diskretion und Ruhe hier draussen. Das Geldhaus ist in einer Villa mit TĂŒrmchen, Erkern und Giebelchen untergebracht. Auf dem Parkplatz vereinsamt ein Opel unter der Flotte von Porsches, Mercedes, BMWs und einem Renault. Die Bank wurde 1994 gegrĂŒndet, seit 1999 firmiert sie unter dem heutigen Namen und ist an der Schweizer Börse kotiert. Rund die HĂ€lfte der Aktien gehört den hundert Mitarbeitern.
«Derzeit betreuen wir vier Milliarden Franken an Kundenvermögen», berichtet unser Kundenberater stolz, «und wollen jedes Jahr um zwanzig Prozent wachsen.» Herr Hofer trĂ€gt einen Nadelstreifenanzug und eine gelbe Krawatte mit doppeltem Windsor. Herr Hofer ist stets zwei Schritte voraus, hĂ€lt TĂŒren auf und beantwortet Fragen zu Schwarzgeld in ruhigem Tonfall. Wir nehmen im Besprechungsraum Platz. Parkett, hölzerne KassettentĂ€felung, ein wuchtiger Holztisch, zwölf StĂŒhle mit grĂŒnem Lederbezug.
«Letztlich brauchen Sie sich gar nicht den Kopf zu zerbrechen», sagt Herr Hofer. «Das Geld kann ich Ihnen schon abnehmen. » Er lĂ€chelt ob der Doppelbedeutung. Er meint wohl den Transport aus Deutschland. Denn Herr Hofer versichert, er kenne Möglichkeiten, gewisse Summen in die Schweiz zu bringen. «Ich bin oft in Hamburg », sagt er und zwinkert uns zu. «Sie bekommen eine Quittung, und das Geld wird Ihnen hier gutgeschrieben.» Es gĂ€be auch «Schweizer Concierges» in Deutschland, die könnten das Geld ĂŒbernehmen, zum Beispiel 200'000 Euro.
Das alles sei natĂŒrlich Vertrauenssache, betont der Banker. Aber er habe Familie. Er werde sich gewiss nicht mit unserem Schwarzgeld absetzen. «Bestimmt nicht», versichert er uns und schmunzelt. «Weil ich öfter in Deutschland bin, kann ich Ihnen auch die DepotauszĂŒge mitbringen», ergĂ€nzt Herr Hofer.
Wahlweise liesse sich auch bei einer Bank in Lugano ein Visa-Kartenkonto eröffnen, sagt Herr Hofer. Mit den Einzahlungen auf dieses Konto könnten wir dann unsere Ausgaben bestreiten. «Niemand kann Ihnen verbieten, an einem spanischen Postschalter Geld auf ein Visa-Konto in der Schweiz einzuzahlen. Das ist absolut legal.» Ein Àlteres Ehepaar habe anfangs auch eher Àngstlich solche Transfers getÀtigt. Jetzt mache es ihnen richtig Spass. «Wenn die beiden auf Kreuzfahrt gehen, begleichen sie mittlerweile sÀmtliche Ausgaben mit ihrer Visacard », weiss der Schweizer Banker.
Wir nicken beeindruckt. Trotzdem möchten wir wissen, ob denn die Herkunft unseres Geldes nicht ĂŒberprĂŒft werde. Dazu sei er gesetzlich verpflichtet, antwortet Herr Hofer. Seit dem 11. September 2001 seien viele Finanztransaktionen ins Zwielicht geraten. Wenn wir unser Geld bereits nach wenigen Monaten ĂŒber dubiose KanĂ€le aus der Schweiz weiterverschieben wĂŒrden, wĂ€re das schon etwas suspekt. Doch wir suchten ja eine langfristige Anlage, sagt Herr Hofer. Er sei ein positiver Mensch, ganz nach dem Grundsatz «in dubio pro reo», wobei wir natĂŒrlich keine Angeklagten seien. Der Banker lacht.
Herr Hofer hat klare Vorstellungen, wie er unser Vermögen splitten will. «Wir werden ein offizielles Kundendepot fĂŒr Sie eröffnen, mit Namen und so, und ein inoffizielles Nummernkonto. DafĂŒr geben wir Ihnen ein Codewort. Beim diskreten Geld können wir etwas kreativer sein und mĂŒssen nicht immer so genau auf die Spekulationsfrist in Deutschland achten», sagt er.
Und die Zinssteuer?, wollen wir wissen.
Ja, der Herr Eichel brauche dringend Geld, sagt Hofer mit gespielter Anteilnahme. Von uns mĂŒsse der Finanzminister aber sicherlich nichts bekommen, meint der Bankberater. «Die Zinssteuer gilt ja nicht fĂŒr Produkte, die vor dem 1. MĂ€rz 2001 aufgelegt wurden», sagt Herr Hofer stoisch.
Herr Hofer hat noch andere gute RatschlĂ€ge auf Lager. Ob wir schon einmal ĂŒber eine Familienstiftung nachgedacht hĂ€tten? Im Liechtensteinischen. Die Swissfirst habe im FĂŒrstentum eine DĂ©pendance. «Wir grĂŒnden sehr viele Stiftungen dort», sagt Hofer. Mit einem solchen «juristischen GefĂ€ss» brĂ€uchten wir auch keine Zinssteuer zu zahlen, oder mit den Worten von Herrn Hofer ausgedrĂŒckt: «Mit einer Stiftung kann man Sie an einen LĂŒgendetektor anschliessen und nach einem Schweizer Konto fragen. Sie haben keins, das hat ja die Stiftung.»
Deutsche Bank
Der Mitarbeiter der Deutschen Bank in ZĂŒrich trĂ€gt einen Schnauz und eine braune Krawatte. Er spricht bedĂ€chtig und gibt sich gelassen. Zum Transfer des Schwarzgeldes mag sich Eugen Mertens nicht Ă€ussern. «Das mĂŒssen Sie wissen», meint er ganz ohne Augenzwinkern. Der Berater hat allen Grund, vorsichtig zu sein. Sein Mutterhaus, die Deutsche Bank, das grösste Finanzinstitut Europas, hat seinen Hauptsitz in Frankfurt, in der EU, wo es kein Bankgeheimnis Ă la Suisse gibt. Im Gegenteil. Herr Mertens sagt klipp und klar: «In Deutschland sind die Daten jedes Bankkunden zugĂ€nglich.»
Die Schweizer Niederlassung der Deutschen Bank, die gut 30 Milliarden Franken an Kundenvermögen betreut, ist allerdings dem hiesigen Recht unterstellt und geniesst somit einen Sonderstatus. «Das gute alte Bankgeheimnis», sagt Herr Mertens, es soll nun sogar in der Verfassung festgeschrieben werden.
Sobald also das Geld einmal in ZĂŒrich sei (auch hier: «bitte mit Herkunftsnachweis »), sei es sicher.
«Aber wie sieht es mit der Zinssteuer der EU aus, die nÀchstes Jahr auf auslÀndischen Vermögen erhoben werden soll?», wollen wir wissen.
«Sie können beruhigt sein, dass wir bereits tolle Produkte in der Pipeline haben, mit denen diese Steuer umgangen werden kann», sagt Herr Mertens mit der grössten SelbstverstĂ€ndlichkeit. Ausserdem gebe es schon heute eine Lösung fĂŒr sĂ€mtliche Steuern: eine Lebensversicherung, abgeschlossen im FĂŒrstentum Liechtenstein. Wie wir von Herrn Mertens erfahren, ist die Police vollkommen steuerbefreit und gemĂ€ss Versicherungsgesetz absolut geheim. Das Beste daran, betont der Deutsch-Banker: «Das Ganze ist Ă€hnlich wie eine Stiftung konzipiert. » «Stiftung light» heisst es in der BroschĂŒre, die uns Herr Mertens zum Abschluss freundlicherweise ĂŒberreicht. Darin lesen wir: «⊠Stiftung light, so dass einer nahezu beliebigen Verteilung Ihres Vermögens nichts mehr im Wege steht».
Wir sind diskret. Zum Abschied hinterlassen wir Herrn Mertens bloss unsere wahren Namen. Er erkundigt sich nicht weiter.
Bank Julius BĂ€r
Zum Bankhaus Julius BĂ€r weist an der ZĂŒrcher Bahnhofstrasse ein unauffĂ€lliges Schild. Der Eingang liegt in einer Seitenstrasse. Ein paar Minuten sitzen wir beim Empfang in einer diskreten Wartenische hinter Milchglas. Die ZĂŒrcher Privatbank wird heute in der vierten Generation gefĂŒhrt. In ihren Kundendepots lagern gegen 120 Milliarden Franken. Schon kommt Christian Scherer, der uns in den dritten Stock fĂŒhrt. An der Wand hĂ€ngt ein grosses modernes GemĂ€lde - bunte Planeten, die wie Seifenblasen durchs All fliegen. «Wir raten davon ab, Steuern zu hinterziehen. Wir möchten keine aktive Beihilfe leisten», stellt unser Berater zu Beginn klar, ganz der ruhige, sachliche Profi. Wir verstehen.
KĂŒrzlich sorgte der EhrenprĂ€sident des Hauses, Hans J. BĂ€r, fĂŒr einige Aufregung, als er sich in seinen Memoiren mit dem sinnigen Titel «Seid umschlungen, Millionen» kritisch ĂŒber das Schweizer Bankgeheimnis ausliess. In dem Werk wirft er den helvetischen Bankiers vor, die Steuerflucht auslĂ€ndischer StaatsbĂŒrger zu begĂŒnstigen
und sich daran noch zu bereichern. «Tja», wollen wir wissen, «bleibt das Bankgeheimnis ĂŒberhaupt bestehen?»
«Aber sicher», sagt Herr Scherer. Die Ăberlegungen zum Bankgeheimnis, die BĂ€r senior in seinen Lebenserinnerungen angestellt habe, seien gerade mal vier Zeilen in einem mehr als 450-seitigen Buch. Und schliesslich sei Herr BĂ€r ja frei, seine Gedanken zu Papier zu bringen. «Aber das Bankgeheimnis», versichert Herr Scherer, «das bleibt. Dies kann kein Amt in Deutschland verĂ€ndern.»
Einmal mehr nicken wir bestimmt. «Bloss, wie sollen wir das Bargeld in die Schweiz bringen?»
Dem Banker ist anzumerken, dass er diese Frage bemĂŒhend findet. Jetzt wirkt er fast ein wenig beleidigt. Wahrscheinlich interessieren sich die meisten deutschen Kunden mehr fĂŒrs Steuersparen als fĂŒr seine akkuraten Grafiken, in denen viele bunte Punkte Rendite und Risiko bestimmter Anlagestrategien darstellen.
Dennoch zeigt Herr Scherer VerstĂ€ndnis fĂŒr unser Anliegen und ist plötzlich gut informiert: «Mit BetrĂ€gen von mehr als 20'000 Euro in die Schweiz zu reisen, ist immer gefĂ€hrlich.» Der Zoll sehe das gar nicht gerne. 15'000 Euro seien das Maximum. Darum lieber öfter und mit kleineren Mengen kommen. Herr Scherer gibt uns allerdings nun klar zu verstehen: Wer bei ihm Kunde werden will, braucht schon etwa eine Million Franken auf dem Konto.
«Also doch mit dem Flugzeug?», entgegnen wir.
«Ich darf Ihnen doch keine Tipps geben! », mahnt Herr Scherer.
WofĂŒr sind wir dann hergekommen? Schweigen in der Runde. Da hat Herr Scherer wieder eine Idee: die Versicherungslösung. «Um das Portefeuille legen wir eine Versicherungspolice, wie eine Schwimmweste », sagt er - wodurch das Geld von der Einkommenssteuer befreit ist. Bloss: Bei dieser Variante mĂŒssten wir fĂŒnf Jahre lang die gleiche Summe einzahlen und kĂ€men erst noch zwölf Jahre nicht an das Vermögen heran. Wir zögern.
«Wie auch immer», sagt der Banker und will uns am Ende ein Exemplar von Hans J. BĂ€rs Memoiren mit auf den Weg geben. Aber im Moment ist das Buch im Haus nicht vorrĂ€tig. Als uns Herr Scherer am Ausgang verabschiedet, meint er noch: «Auf jeden Fall mĂŒssen Sie zwei Konten anlegen - schwarzes und weisses Geld sollte man nie mischen.»
UBS
Diese Ansicht teilt auch Rolf StĂŒber: «Stellen Sie sich eine Kiste mit frischen Ăpfeln vor. Wenn Sie da einen Verfaulten hinzu tun, fangen auch die anderen an zu faulen», sagt der Kundenberater der UBS am Hauptsitz in ZĂŒrich. Die grösste Bank der Schweiz verwaltet am meisten Geld auf der Welt: gut 2200 Milliarden Franken.
Im Sitzungsraum steht neben Herrn StĂŒber eine hĂŒfthohe Vase mit SchilfstĂ€ngeln, hinter ihm hĂ€ngt ein grosses rotes Bild. Es ist das gleiche Rot wie das des LĂ€mpchens bei der TĂŒr, das leuchtet, seit das Besprechungszimmer besetzt ist. Als eine junge Frau das Wasser ohne KohlensĂ€ure serviert, erklĂ€rt Herr StĂŒber gerade den Unterschied zwischen Steuerhinterziehung («Sie vergessen einige Angaben beim AusfĂŒllen der SteuererklĂ€rung. Ist in der Schweiz eine blosse Ăbertretung, die nur mit einer Busse geahndet wird. Die Schweiz leistet dafĂŒr keine Amtshilfe ins Ausland») und Steuerbetrug («Sie fĂ€lschen Dokumente beim AusfĂŒllen der SteuererklĂ€rung. Ist in der Schweiz ein Strafdelikt. DafĂŒr werden Sie gebĂŒsst, und die Schweiz leistet Rechtshilfe ins Ausland»). Seine Stimme ist gedĂ€mpft.
Aber die deutschen Behörden geben sich damit nicht zufrieden. StĂŒber weiss von deutschen Steuerfahndern, die schon mal in ZĂŒrich nach teuren deutschen Autos Ausschau halten.
Ob es am Schluss doch nicht besser sei, das Geld in Deutschland zu deklarieren, wollen wir wissen.
Herr StĂŒber schĂŒttelt den Kopf: «Das wĂ€re nicht gut. Ihre Eltern mĂŒssten viele unangenehme Fragen beantworten.»
Und was ist mit der Amnestie-Regelung von Finanzminister Eichel? SteuersĂŒnder sollen fĂŒr ein geringes Entgelt ihr Vermögen wieder nach Deutschland repatriieren können, schiessen wir weiter mit Fragen.
«Problematisch», erwidert Herr StĂŒber, «dann sind Sie fĂŒr immer auf deren Radar», sagt der Banker und nestelt an seiner dezent gelb und rot gestreiften Krawatte. «Damit strafen Sie am Ende nur sich selber.»
«Wie Sie das Schwarzgeld an den Fahndern vorbei in die Schweiz bringen, ist Ihre Sache», sagt Herr StĂŒber, «da kann ich Ihnen keine Beratung geben.»
Sobald es aber da sei, jetzt leuchten StĂŒbers Augen, brauche er bloss noch einen Nachweis ĂŒber die Herkunft («irgendein Papier vom Anwalt Ihres Vaters»). Danach sei das Geld fĂŒr ihn in Ordnung. Der Steueroptimierung seien dann keine Grenzen mehr gesetzt - entweder «thesaurierend» oder «ertragsschonend». Im ersten Fall wĂŒrden die Zinsgewinne laufend reinvestiert, so dass keine ErtrĂ€ge anfielen, im zweiten Fall «gehen wir einfach nach Jersey, dann entfĂ€llt die Steuer ganz», schmunzelt Herr StĂŒber.
FĂŒr welche Anlageform man sich letztlich entschliesst - Diskretion ist fĂŒr den Banker der UBS das A und O der Kundenbeziehung. Zwar verschicke die UBS ihre Briefe ohnehin in neutralen Kuverts. Doch die UmschlĂ€ge hĂ€tten eine winzige Referenznummer an der Unterseite. «Die kennen sie bei der deutschen Post und rufen gleich die Steuerfahndung an.» Deshalb sei auch ein Nummernkonto besser, zumindest fĂŒr das diskrete Geld - Korrespondenz immer banklagernd.
Herr StĂŒber klappt seine Mappe mit der bunten PrĂ€sentation zu und sagt: «Die sollte man besser nicht auf der RĂŒckreise bei Ihnen finden.» Zum Abschied dĂŒrfen wir aus seinen VisitenkĂ€rtchen eins auswĂ€hlen: Das eine ist mit, das andere ohne Logo der UBS. Nach Hamburg komme er gelegentlich - in Jeans und Turnschuhen. Auch um Kunden zu treffen.
* Die Namen aller Bankmitarbeiter wurden geÀndert
|
 Thread-Ansicht
Thread-Ansicht Mix-Ansicht
Mix-Ansicht