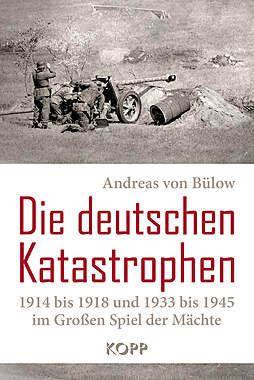Die Baisse der Reichen
Eigentlich haben wir es ja schon immer geahnt, doch jetzt haben wir es endlich schwarz auf wei√ü. Es gab nat√ľrlich auch vorher schon viele Indizien, wovon die Prozentrechnung das wichtigste ist. Denn es ist eine verdammt schlichte Rechnung und eine verdammt schlichte Erkenntnis:
Die jetzt erst wohl endg√ľltig verblichene Hausse war nicht die Hausse des"kleinen Mannes". Denn dass man dann, wenn man nicht viel besitzt, gerade an der B√∂rse reich werden kann, ist ein genauso ein Ammenm√§rchen wie beispielsweise die Geschichte von der schmerzlosen Geburt. Mit dem Unterschied allerdings, dass sich aus letzterem f√ľr den Versprechenden vergleichsweise deutlich weniger Profit erzielen l√§sst als aus ersterem...
Eigentlich muss man dazu nur einen Blick auf die Prozentrechnung werfen: Denn um mit einem Einsatz von beispielsweise 10.000 DM zum Million√§r zu werden, muss man eine Performance hinlegen, die 9.900 Prozent nicht unterschreiten darf. Wohingegen derjenige, der bereits 10 Millionen DM besitzt, nur noch einen schlappen Anstieg von 10 Prozent ben√∂tigt, um ebenfalls eine Million DM"zu machen". Man sieht also, wie fahrl√§ssig das Versprechen"Ich mache Sie zum Million√§r" selbst angesichts des Rekordstandes des Neuen Marktes im Fr√ľhjahr 2000 gewesen ist.
Zu den gleichen Ergebnissen wie die reine Logik der Prozentrechnung kommt nun auch eine neue Studie im Auftrag der US-Notenbank. Konkret: Die Kursgewinne der letzten Jahre entfielen weit √ľberproportional auf die einkommensst√§rksten 20 Prozent der US-B√ľrger. Es war also eine Hausse der Reichen - und der Rest hat wohl weitgehend nur zugesehen beziehungsweise mit einem Taschengeld mitgespielt, jedoch keinen nennenswerten Reichtum aufgeh√§uft.
Die"Hausse der Reichen" damals bedeutet nun aber umgekehrt auch die"Baisse der Reichen" jetzt, was durchaus interessante Einblicke in die gegenw√§rtige Situation nicht nur der US-Wirtschaft erlaubt. Denn parallel zur Hausse der 90er Jahre haben wir in den USA einen dramatischen R√ľckgang der privaten Sparquote 8 Prozent auf derzeit minus 0,7 Prozent erlebt. H√§ngt nun, was durchaus plausibel ist, das Sparverhalten mit der Aktienkursentwicklung zusammen, so kann man nun daraus folgern, dass dieser R√ľckgang der Sparquote ebenfalls √ľberproportional den h√∂heren Einkommensschichten zuzuordnen ist.
Das wiederum hei√üt jedoch: Die Sparneigung der US-Normalb√ľrger ist offenbar h√∂her als die Durchschnittszahlen, von denen wir immer reden, uns zeigen. Am Konsum- und Sparverhalten des Normalb√ľrgers ist die Hausse also spurloser vorbeigegangen als wir das bef√ľrchten mussten, weshalb auch in der Baisse die Angst vor den negativen Verm√∂genseffekten auf den Konsum nicht √ľbertrieben werden sollte. Denn der Hauptteil des Konsums wird durch das verursacht, was zwar schrecklich nach Gewerkschaft und alter SPD klingt, dadurch jedoch nicht falsch wird, - n√§mlich durch den"Massenkonsum". Und dieser ist viel eher von der Lohnentwicklung als von den Verm√∂genseffekten abh√§ngig.
Gott sei Dank sind wir also trotz vielf√§ltiger anderer Attit√ľden in den Medien und in der Werbung anscheinend √ľberall so"proletarisch" geblieben, dass jetzt sogar der B√∂rsianer vom Mann auf der Stra√üe das Sicherheitsnetz gespannt bekommt. Anders sieht es hingegen im Bereich der G√ľter aus, die nahezu ausschlie√ülich von den hohen Einkommensschichten gekauft werden. Die Verm√∂genseffekte wirken also nicht wie eine Schrotflinte, sondern eher wie ein gezielter Schuss auf das, was vorher √ľberproportional in die H√∂he gestiegen ist. Eine allgemeine Bedrohung unser Wirtschafts- und B√∂rsensituation droht also von dieser (!) Seite nicht.
Doch noch ein Wort zum Schreckensgespenst der niedrigen Sparquote in den USA: Weil sich die H√∂he der Ersparnisse statistisch nicht erfassen l√§sst errechnet sie sich ausschlie√ülich als Restgr√∂√üe dessen, was im Inland verdient und nicht f√ľr Konsum oder Investitionen verausgabt wurde. Es gibt daher grunds√§tzlich zwei verschiedene Arten einer niedrigen Sparquote: Entweder, die Ersparnisse sind niedrig und die Investitionen sind es auch. Oder aber, die niedrigen Ersparnisse korrespondieren mit hohen Investitionen, wobei die Differenz aus Kapitalimporten gespeist wird. Dies f√ľhrt zwar zu einer gewissen Abh√§ngigkeit vom Ausland, doch diese ist tats√§chlich nur dann tragisch, wenn sie in Fremdw√§hrung besteht.
Innerhalb des Universums statistisch niedriger Sparleistungen leben die USA also in der besten aller Welten. Denn sie haben immerhin eine hohe Investitionsquote, welche sie sich gegen Dollarverbindlichkeiten von den Ausl√§ndern finanzieren lassen. So etwas kann sich nat√ľrlich nur das Leitw√§hrungsland leisten, wovon die USA denn auch heftigen Gebrauch machen. Den Weltfinanzen droht damit allerdings so lange kein ernsterer Schaden, wie die USA ihre Hegmonialstellung behaupten k√∂nnen.
Ein viel größerer Sprengsatz als die niedrige Sparquote in den USA wäre daher ein selbstbewusster und starker Euro. Bleibt zum Schluss also nur noch die eine Frage: Ist der Euro vielleicht exakt aus diesem Grund so schwach?
Bernd Niquet
15.06.2001
<center>
<HR>
</center> |
 Thread-Ansicht
Thread-Ansicht Mix-Ansicht
Mix-Ansicht