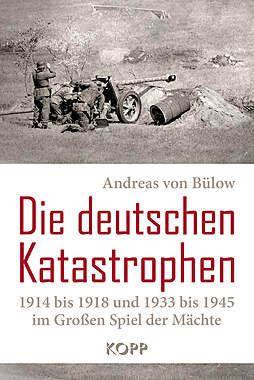- Bush betreibt: ''Voodoo Economics'' - kizkalesi, 28.12.2002, 09:45
- Re: Bush betreibt: ''Voodoo Economics'' - RetterderMatrix, 28.12.2002, 10:14
Re: Bush betreibt: ''Voodoo Economics''
-->Präsident Lyndon Ronald Bush
Die US-Haushaltspolitik gefährdet die Stabilität der globalen Finanzen und des Welthandels - Debatte
von Harold James
Trotz der Turbulenzen in den Jahren 1997 und 1998 war das Wirtschafts- und Finanzsystem in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts stabiler als in fr√ľheren Jahrzehnten. Diese Stabilit√§t schwindet momentan jedoch rasch - und mit ihr der prinzipielle Konsens, auf dem sie beruhte. Eines der bedeutendsten Elemente dieses Konsenses war die Idee der finanzpolitischen Verantwortung - international als ‚ÄěWashington-Konsens? bekannt. In den USA folgte man damit der Erkenntnis Pr√§sident Clintons, wonach ausgeglichene Budgets die Finanzm√§rkte stabilisieren, die Kreditkosten senken und daher f√ľr besseres Wachstum sorgen w√ľrden. Clinton setzte diese Politik auch gegen√ľber dem misstrauischen Kongress durch - selbst um den Preis, daf√ľr einige seiner sozialpolitischen Wahlversprechen opfern zu m√ľssen. In Europa wurde dieser Konsens in den Wachstums- und Stabilit√§tspakt der EU aufgenommen und in Form der strengen Maastricht-Kriterien in die Praxis umgesetzt.
Heute ist dieser finanzpolitische Konsens nachhaltig infrage gestellt. Portugal, Deutschland und Frankreich erkl√§ren ihre Absicht, von den Maastricht-Kriterien abzuweichen. Aber vor allem die USA f√ľhren den Feldzug gegen die Budgetdisziplin an. Das amerikanische Bundeshaushaltsdefizit betrug in den Jahren 2001/02 159 Milliarden Dollar. Gemessen an europ√§ischen Standards eine durchaus respektable Summe. Allerdings wird auf Grund des verantwortungslosen Umgangs mit Steuersenkungen noch mehr rote Tinte n√∂tig sein - und im Gegensatz zu Clinton oder auch Bush senior beabsichtigt George W. Bush keineswegs, seine Wahlversprechen zu brechen.
In seinem Wahlprogramm versprach Bush einschneidende Steuersenkungen, die er nach seiner Wahl auch vorantrieb. Auf Einw√§nde, wonach das Haushaltsdefizit explodiere, meinte er: ‚ÄěWir haben ein Defizit, weil die Steuereinnahmen gesunken sind.‚Äú Und das Steuerentlastungspaket ‚Äěhat der Wirtschaft geholfen. Ohne diese Ma√ünahmen w√§re das Defizit noch gr√∂√üer.‚Äú Bush glaubt also, dass Steuersenkungen zu einer Verringerung des Haushaltsdefizits f√ľhren. Das ist allerdings genau jene Art von ‚ÄěAngebots√∂konomie‚Äú, die sein Vater bei Ronald Reagan als ‚ÄěVoodoo Economics‚Äú anprangerte.
Zwei Schreckgespenster liegen dieser Theorie zu Grunde. Das wirtschaftliche Trauma Japans in den neunziger Jahren, als sich Finanz- und Steuerpolitik angesichts einer hartn√§ckigen Deflation als wirkungslose Instrumente herausstellten, wird nun herangezogen, um Bushs ausgedehntes Zehnjahresprogramm f√ľr Steuersenkungen zu rechtfertigen. Das zweite Schreckgespenst ist der 11. September. Zu Beginn des Jahres 2002 schlug der Pr√§sident eine Erh√∂hung der Milit√§rausgaben um 48 Milliarden Dollar vor. Insgesamt betr√§gt das amerikanische Milit√§rbudget 396 Milliarden Dollar, liegt also knapp unter vier Prozent des BIP. Im Falle eines Krieges mit dem Irak w√ľrden noch einmal 100 Milliarden Dollar, oder ein Prozent des BIP, dazukommen. (Der Krieg in Afghanistan schlug mit bescheidenen zehn Milliarden Dollar zu Buche.)
In der amerikanischen Geschichte mussten solche Schreckgespenster schon oft zur Rechtfertigung von Haushaltsdefiziten herhalten. In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts glaubte Pr√§sident Reagan, Amerika w√ľrde seine wirtschaftliche F√ľhrungsposition an Japan und Europa verlieren, und so nahm er auch ein wachsendes Defizit in Kauf. In den sechziger Jahren f√ľrchtete Pr√§sident Johnson eine gro√üe Depression wie in den drei√üiger Jahren und reagierte darauf mit h√∂heren Sozialausgaben, w√§hrend gleichzeitig auch die Milit√§rausgaben durch die Eskalation des Vietnamkrieges in die H√∂he schnellten.
In beiden Zeitr√§umen f√ľhrte mangelnde Budgetdisziplin zu Unbest√§ndigkeit auf den Devisenm√§rkten, wo durch den akuten Anstieg der Inflation in den sechziger Jahren das Bretton-Woods-Wechselkurssystem zusammenbrach. Darauf kam es zu einer Welle gegenseitiger Schuldzuweisungen √ľber den Atlantik. Die Europ√§er (vor allem die Franzosen und Deutschen) beschuldigten die Vereinigten Staaten eines verantwortungslosen Inflationismus, w√§hrend die Amerikaner den Europ√§ern vorhielten, sie w√ľrden sich weigern, das Wirtschaftswachstum schnell genug voranzutreiben. Diese Episode trug wesentlich zum Antiamerikanismus in Europa bei. In den achtziger Jahren stieg der Dollar gegen√ľber dem Yen und den europ√§ischen W√§hrungen enorm an und brach anschlie√üend ein. Wieder √ľbte man sich auf beiden Seiten des Atlantiks in gegenseitigen Schuldzuweisungen.
Derartige Bewegungen f√ľhren zu enormen Ver√§nderungen der realen Wechselkurse und daher auch der Wettbewerbsf√§higkeit, wodurch wiederum der Ruf nach handelspolitischen Schutzma√ünahmen laut wird. Eine neue Welle von Haushaltsdefiziten und Wechselkursinstabilit√§ten w√ľrde daher das grundlegendste und wertvollste Verm√§chtnis der neunziger Jahre infrage stellen: die Bem√ľhungen um die √É-ffnung und Liberalisierung des Handels.
Zuweilen vertrauen die Menschen zu sehr auf die St√§rke und Unumkehrbarkeit der Globalisierung. Genau diese Entwicklung ist durch die finanzpolitischen und wirtschaftlichen Turbulenzen infrage gestellt. Die Welt ist heute integrierter als in den sechziger oder achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die j√ľngsten Ereignisse zeigen allerdings, dass wir heute f√ľr einen pl√∂tzlichen und unsanften R√ľckschlag anf√§lliger denn je sind.
Harold James ist Professor f√ľr Geschichte an der Princeton University.
<ul> ~ http://www.welt.de/data/2002/12/28/28223.html</ul>
gesamter Thread:
 Mix-Ansicht
Mix-Ansicht