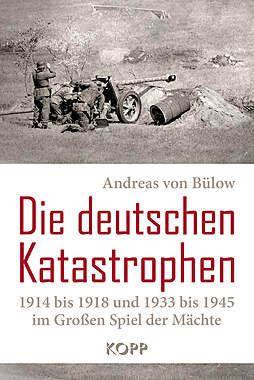- Desert Storm - Kuwait wollte Wiedervereinigung? - saschmu, 10.06.2003, 15:16
- Scholl-Latour dazu: - HB, 10.06.2003, 16:55
- Der Text ist unten abgeschnitten worden. - SchlauFuchs, 10.06.2003, 17:53
- Der Rest des Kapitels: - HB, 10.06.2003, 18:07
- Der Text ist unten abgeschnitten worden. - SchlauFuchs, 10.06.2003, 17:53
- Scholl-Latour dazu: - HB, 10.06.2003, 16:55
Der Rest des Kapitels:
-->Sorry, habe ich gar nicht gemerkt, hier der Rest des Kapitels:
------------------------------------------------------------------------------
Im Norden wiederum wÀre die Auflösung des Bagdader Staatsapparates von den Kurden genutzt
worden, um im Raum von Mossul, Kirkuk, Suleimaniyeh und Halabja eine souverÀne Republik zu
proklamieren. Was wiederum die tĂŒrkische Regierung in Ankara und die dortige ArmeefĂŒhrung, die in
Ost-Anatolien in einen endlosen Partisanenkrieg gegen die Stalinisten der PKK verstrickt sind, zur
militÀrischen Intervention, ja vielleicht zur dauerhaften Okkupation der irakischen Nordprovinzen
bewogen hÀtte. Kurzum, die Erhaltung des territorialen Status quo erschien den geopolitischen Planern in
Washington als das geringere Ăbel. Der Geheimdienst CIA ging im ĂŒbrigen von der GewiĂheit aus, daĂ
Saddam Hussein nach seiner schmĂ€hlichen Niederlage vom eigenen Offizierskorps gestĂŒrzt wĂŒrde und
daà man sehr bald in Bagdad mit einem neuen Machthaber verhandeln könne. Am Tigris ist mir versichert
worden, der irakische Staatschef habe höchstpersönlich das GerĂŒcht dieses unmittelbar bevorstehenden
MilitÀrputsches den amerikanischen Agenten zuspielen lassen, um George Bush in Sicherheit zu wiegen
und sein eigenes Ăberleben zu ermöglichen.
Der babylonische PrÀzedenzfall des Frevlers Belsazar, den die Bibel schildert und den Heinrich Heine in
seiner Ballade popularisierte, hat sich nicht wiederholt: »... Belsazar ward aber in selbiger Nacht von
seinen Knechten umgebrachte Aus dem Blitzsieg von »Desert Storm« war ein Pyrrhus-Sieg geworden.
Daran konnte auch der römisch anmutende Triumphzug des General Schwarzkopf an der Spitze seiner
Soldaten auf der Fifth Avenue von New York nichts Àndern.
*
Nichts liegt mir ferner, als das Lied des »ugly American«, des hĂ€Ălichen Amerikaners, anzustimmen. Aber
mit allen Registern ist im Golfkrieg gegen Irak »foul« gespielt worden. Die IrrefĂŒhrung der Medien und
der Weltöffentlichkeit hat vor, wĂ€hrend und nach dem Unternehmen »WĂŒstensturm« groteske AusmaĂe
angenommen. Wer konnte wÀhrend des US-Bombardements noch unterscheiden zwischen realen
Luftaufnahmen und Computer-Simulierungen? Die Zahl der rund um Kuweit massierten irakischen
Truppen wurde extrem aufgebauscht. Nach ihrem Einmarsch in Kuweit haben sich die Soldaten Saddam
Husseins ganz bestimmt nicht wie Gentlemen aufgefĂŒhrt. Aber sie waren auch nicht die Bestien in
Menschengestalt, als die sie von der amerikanischen Greuelpropaganda dargestellt wurden. PlĂŒnderungen
in groĂem AusmaĂ fanden statt, und das Beutegut ist teilweise heute noch - vom KĂŒhlschrank bis zum
Kronleuchter aus Kristall - in gewissen Valuta-KaufhÀusern Bagdads zu erstehen. Oft waren jedoch
ortsansÀssige Kuweiti an diesen SeriendiebstÀhlen beteiligt. Ich habe mich von libanesischen Kaufleuten,
die den ganzen Krieg im okkupierten Scheikhtum miterlebt haben, ausfĂŒhrlich informieren lassen. Die
Iraker sollen sich nicht wesentlich schlimmer aufgefĂŒhrt haben, als das andere arabische Eroberer in
vergleichbarer Situation getan hÀtten. Die Verschleppung und die Hinrichtung potentieller politischer
Gegner, die nicht rechtzeitig fliehen konnten, sind leider gelÀufige Praxis im ganzen Orient.
Es gibt Situationen, in denen die EuropĂ€er ihrem ĂŒbermĂ€chtigen BĂŒndnispartner jenseits des
Atlantiks nicht jeden Streich durchgehen lassen sollten. Eine Portion Gaullismus stĂŒnde den
verantwortlichen Politikern unseres alten Kontinents gut zu Gesicht, was eine tief verankerte SolidaritÀt
mit Amerika keineswegs ausschlieĂt. Auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise, als die Welt sich am Rande
des Atomkrieges befand, hatte Charles de Gaulle - bei all seinen Vorbehalten gegen den westlichen
Hegemonen - dem EmissĂ€r John E Kennedys, Dean Acheson, auf englisch, was fĂŒr ihn Ă€uĂerst
ungewöhnlich war, deklariert: »If there is a war, we shall be with you - Wenn es zum Krieg kommt, stehen
wir auf Eurer Seite.« Aber gewisse »dirty tricks« können einfach nicht hingenommen werden. Ein
Paradebeispiel dieser geheimdienstlichen Abgefeimtheit war wohl die Horror-Erfindung von den
BrutkĂ€sten fĂŒr SĂ€uglinge in einem Kuweiter Krankenhaus, die von den Irakern angeblich zertrĂŒmmert
wurden. Die Babys seien dann von diesen Sadisten an den WĂ€nden zerschmettert worden. Um diesen
Behauptungen GlaubwĂŒrdigkeit zu verleihen, war eine englische TV-Produktionsfirma speziell beauftragt
und bezahlt worden, das Gruselspiel absichtlich verwackelt und leicht verzerrt mit Schauspielern zu
inszenieren und den SĂ€uglingsmord anhand von Puppen zu simulieren. Dazu gesellte sich die Tochter des
Botschafters von Kuweit in den USA, um ĂŒber sĂ€mtliche FernsehkanĂ€le mit trĂ€nenerstickter Stimme
GreuelmÀrchen zu verbreiten, die sie im fernen New York frei erfunden hatte.
Nach Ende der Bodenoffensive kam die Sensationsnachricht von irakischen Giftgas-AnschlÀgen
gegen die vorrĂŒckenden Amerikaner auf. In Wirklichkeit hatte die US Army - von ihrem voll informierten
Nachrichtendienst unzureichend gewarnt - Bunkerstellungen des Gegners gesprengt, in denen
Gasgranaten und Sarin-Kampfstoff lagerten. Seitdem ist in den USA der Streit im Gang um die
EntschÀdigung der durch eigenes Verschulden verseuchten amerikanischen Soldaten, deren Zahl von
gewieften AnwĂ€lten beliebig in die Höhe getrieben wird. Nur ein geringer Teil der LĂŒgen und
Fehlleistungen, die den strahlenden Sieg George Bushs ins Zwielicht rĂŒcken, sind bekannt geworden.
Man erinnere sich zum Beispiel an die Tatarenmeldung von der totalen Ă-lverschmutzung des Persischen
Golfs durch auslaufendes Petroleum. Als dazu eine drastische Illustration fehlte, wurde die Fernseh-Aufnahme
eines im Ă-l ertrinkenden Kormorans aus der französischen Bretagne zu Hilfe genommen. um
die EntrĂŒstung der UmweltschĂŒtzer anzufachen.
In einem mit Hilfe des deutschen Nachrichtendienstes entstandenen Sachbuch des FAZ-Redakteurs
Udo Ulfkotte, dessen LektĂŒre fĂŒr naive GemĂŒter ĂŒberaus heilsam wĂ€re, sind die von mir
summarisch aufgezĂ€hlten Pannen mit detaillierter Sachkenntnis aufgelistet. VerblĂŒffend an dieser
Veröffentlichung sind nicht so sehr die Fakten selbst, die in der amerikanischen Presse lĂ€ngst ausfĂŒhrlich
behandelt wurden, sondern die Tatsache, daĂ ausgerechnet der BND zu einer so schonungslosen
Kampagne gegen seine Kollegen der CIA ausholte. In Pullach - das wÀre das wahre Hintergrundthema
besagten Buches - scheint eine gewisse Schizophrenie vorzuherrschen. Einerseits stellt man die US-Agenten
als StĂŒmper und Killer dar, andererseits wird jedoch von Ulfkotte versichert, daĂ ĂŒber den BND
seit geraumer Zeit sÀmtliche deutschen Botschaftsberichte an den israelischen Nachrichtendienst
»Mossad« weitergeleitet werden. Nun ist aber die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und
israelischen »Spooks« aufs engste verzahnt, so daĂ die EnthĂŒllungen Pullachs, die streng vertraulichen
Lagebeurteilungen des AuswĂ€rtigen Amtes, zweifellos ĂŒber Jerusalem ihren Weg nach Langley finden.
Das ertrĂ€gliche MaĂ an Skrupellosigkeit und »intoxication« wurde vollends ĂŒberschritten, als das
US-Kommando die Regimegegner Saddam Husseins - insbesondere die Schiiten im SĂŒden und die
Kurden im Norden - zum offenen Aufstand gegen den Diktator aufrief und sie dann ihrem tragischen
Schicksal ĂŒberlieĂ. Die Kurden, die im Westen ĂŒber eine beachtliche Anzahl von Sympathisanten bei
linken Alternativen und »FriedenskĂ€mpfern« verfĂŒgen, kamen noch relativ glimpflich davon. Sie
profitierten von den amerikanischen SchutzmaĂnahmen, die im Stil der ĂŒblichen SchönfĂ€rberei mit dem
Namen »Northern Shield« und »provide comfort« bezeichnet wurden. Eine schreckliche Untat wurde
hingegen an den schiitischen Gegnern Saddam Husseins begangen. Es war nÀmlich zur Volkserhebung in
den meisten Provinzen sĂŒdlich von Bagdad gekommen. Die AnfĂŒhrer der bislang streng geheimen
Untergrund-Organisationen, insbesondere der militanten Gruppe »El Dawa«, tauchten aus ihren
Schlupflöchern und ihrer AnonymitÀt auf. Die Geheimpolizei Bagdads hatte schon in den siebziger und
Achtziger Jahren zur erbarmungslosen Repression gegen die Mullahs und jene schiitischen Intellektuellen
ausgeholt, die man als Feinde des sĂ€kularen Baath-Regimes, als heimliche BefĂŒrworter eines Gottesstaates
Ă la Khomeini verdĂ€chtigte. Der oberste WĂŒrdentrĂ€ger der »Partei Alis«, Ayatollah Uzma Mohammed
Baqr Sadr, war 1980 hingerichtet worden. Der nÀchste hohe schiitische Geistliche des Irak, Mohammed
Baqr-el-Hakim, entkam nach Teheran, wo er eine »Armee der islamischen Mobilisierung« unter den
schiitischen Kriegsgefangenen aus Mesopotamien zu rekrutieren suchte. Viel effektive Hilfe haben die
AufstĂ€ndischen des SĂŒd-Irak von ihren persischen GlaubensbrĂŒdern dennoch nicht erhalten, als die
Revolte sich im MÀrz 1991 in Windeseile ausbreitete. Teheran hatte sich noch lÀngst nicht von den
horrenden Verlusten des ersten Golfkrieges erholt.
Auch ohne nennenswerten Ă€uĂeren Beistand hatten sich die schiitischen »Gotteskrieger« der
sĂŒdlichen HĂ€lfte des Zweistromlandes bemĂ€chtigt. Nach heftigen Gefechten hatten sie die GroĂstadt Basra
von den Schergen Saddam Husseins befreit, die heiligen PilgerstĂ€tten Nedschef und Kerbela fĂŒr die
»Schiat Ali« zurĂŒckgewonnen. Ihre AnfĂŒhrer vertrauten darauf, daĂ PrĂ€sident Bush die irakische Armee
zumindest daran hindern wĂŒrde, eine Gegenoffensive in Gang zu setzen und blutige Vergeltung zu ĂŒben.
Doch in diesem Punkt hatten sich die Schiiten geirrt. Sie waren auf abscheuliche Weise getÀuscht worden.
Die Kein- und VerfĂŒgungstruppe des Saddam-Regimes, die Divisionen der »Republikanischen Garde«,
waren ja von amerikanischen Luftangriffen verschont geblieben. Sie standen fast unversehrt bereit, um mit
schwerem Material gegen die AufrĂŒhrer vorzugehen. Amerika hatte die Volkserhebung gegen den »Hitler
von Bagdad« mit allen Mitteln der Propaganda ermutigt. Als aber die Perspektive einer schiitischen
Loslösung von der irakischen Zentralmacht sich abzeichnete und die Konturen eines islamischen
Gottesstaates in SĂŒd-Mesopotamien Gestalt annahmen, rĂŒhrten die StreitkrĂ€fte des General Schwarzkopf
keinen Finger, um diesen Irregeleiteten zu Hilfe zu kommen. Sie sahen taten- und wortlos zu, wie die
Revolutionsgardisten unter Befehl des als SchlĂ€chter berĂŒchtigten General Ali Hassan el-Madschid die
StraĂen von Basra in Schutthalden verwandelten, die heilige Stadt Nedschef verwĂŒsteten und das höchste
schiitische Sanktuarium von Kerbela, das Grab des Imam Hussein, in Brand schossen.
Washington hat die rebellischen Schiiten ihrem Todfeind Saddam Hussein bewuĂt ans Messer
geliefert. Zwar war von der US Air-Force ĂŒber breite Streifen im Norden und im SĂŒden des Landes ein
Flugverbot fĂŒr irakische Kampfflugzeuge verhĂ€ngt worden. Aber ĂŒber eine nennenswerte Luftwaffe
verfĂŒgte Bagdad seit Kriegsbeginn ohnehin nicht mehr - die Maschinen waren nach Iran ausgeflogen
worden -, und das Startverbot galt nicht fĂŒr die Hubschrauber, die der Diktator durch geschickte Tarnung
gerettet hatte. Die gepanzerten Helikopter stieĂen nunmehr wie mörderische Raubvögel auf die schlecht
bewaffneten Schiiten nieder. Es fand ein entsetzliches Gemetzel statt. Letzte Zuflucht fanden die
AufstÀndischen in jener malerischen Sumpflandschaft, wo sich das Leben der »Marsh«-Araber seit
prÀhistorischen Zeiten nicht geÀndert hatte. Umgehend ordnete Saddam Hussein an, die potentiellen
Widerstandsnester, dieses einzigartige Naturreservat durch Kanalbau und Drainage auszutrocknen und der
Versteppung auszuliefern.
Die amerikanische Orient-Politik hatte einen doppelten, zutiefst dubiosen Erfolg verbucht:
Saddam Hussein war - mehr noch als bei der Besetzung Kuweits - als grausamer Unhold diskreditiert, und
die Schiiten des Irak wurden als potentielle VerbĂŒndete des iranischen Gottesstaates ausgeschaltet. Die
Vasallen der USA am Persischen Golf - Kuweiti und Saudi zumal - konnten aufatmen. Kein
amerikanischer oder europÀischer Medien-Kommentator wagte die Feststellung zu treffen, daà das US-Kommando
sich gegenĂŒber den Schiiten des Irak Ă€hnlich verhalten hatte wie die Rote Armee Josef
Stalins, als deren Divisionen im Warschauer Stadtteil Praga östlich der Weichsel wie gelÀhmt, ohne auch
nur eine Granate abzufeuern, zusahen, wie Wehrmacht und Waffen-SS den patriotisch und katholisch
motivierten Aufstand des Oberst Bór-Komorowski zusammenkartÀtschten, die polnische Widerstands-Elite
fĂŒsilierten und Warschau in eine Mondlandschaft verwandelten. Ob ein solcher Zynismus sich am
Ende auszahlt? Die »glorreiche Sowjetmacht« ist - trotz oder wegen des stalinistischen Verbrechens an
der Weichsel - zumindest partiell an der ungebrochenen Beharrungskraft Polens gescheitert. Heute deutet
einiges darauf hin, daĂ das skrupellose Doppelspiel zwischen Euphrat und Tigris, dessen sich die USA
schuldig machten, ihnen keinen dauerhaften Vorteil bei der angestrebten »Neuen Friedensordnung«
verschaffen wird.
Blutgericht und Sektentaumel
Bagdad, im August 1997
Der Traum Saddam Husseins, Bagdad in eine strahlende Megapolis zu verwandeln wie zu Zeiten des
Kalifen Harun-al-Raschid, hat sich nicht erfĂŒllt. Sieben Jahre Wirtschaftsembargo haben sich wie Mehltau
auf die Stadt am Tigris gelegt. Wer möchte sich heute noch mit den wuchtigen Wohnblocks des
AuĂenviertels »Saddam City« brĂŒsten, das ursprĂŒnglich »Madinat-el-Thaura - Revolutionsstadt« heiĂen
sollte und nun zum Schauplatz ganz gewöhnlicher KriminalitÀt verkommt. Auch die stattlichen
Apartment-HĂ€user von Haifa-Street - die Namensgebung erinnert an den unverzichtbaren Anspruch auf
die israelische Hafenstadt - beeindrucken nicht mehr. Sie sind - wie so viele Neubauten - einer
schleichenden Abnutzung ausgeliefert.
Bagdad im Sommer 1997 wirkt weit weniger protzig als fĂŒnfzehn Jahre zuvor. DafĂŒr hat die
Kapitale zu einer anheimelnden orientalischen Menschlichkeit zurĂŒckgefunden. Plötzlich stelle ich fest,
daĂ die alte HauptstraĂe parallel zum Strom, die nach Harun-al-Raschid benannt ist, sich seit meinem
ersten Besuch im Sommer 1951 kaum verĂ€ndert hat. Sie ist noch ebenso verdreckt, ĂŒbervölkert und laut
wie wohl schon zur Osmanischen Epoche. Manches offizielle GesprĂ€ch fĂŒhre ich in renovierten,
kasernenĂ€hnlichen Ziegelbauten, die aus der Zeit der tĂŒrkischen Sultansverwaltung stammen. Vor 46
Jahren lieĂen dort die Beamten des Haschemitischen Königshauses dem Besucher von sudanesischen
Dienern Kaffee servieren, wÀhrend dieser auf die Erledigung endloser FormalitÀten wartete. Von der
Pracht des Abbassiden-Kalifats sind allenfalls ein paar Grabkuppeln und ein StĂŒck Festungsmauer ĂŒbrig.
Der zweifache Mongolensturm - einmal unter dem Dschinghis Khan-Enkel HĂŒlagĂŒ, das zweite Mal unter
dem grausamen Welteroberer Tamerlan - hatte die Metropole fast ausgelöscht.
Die Backsteine Mesopotamiens zerbröckeln allzu schnell unter der brĂŒtenden Sonnenglut.
Die DenkmÀler zu Ehren Saddam Husseins, die seit der Golf-Niederlage in unverminderter
Devotion errichtet werden, fallen heute weniger pompös aus. Aber der starke Mann von Bagdad, der -wenn
er lÀchelt und sich leutselig zeigt - ein wenig an den Filmschauspieler Clark Gable erinnert, bleibt
allgegenwÀrtig. Er winkt auf zahllosen WandgemÀlden und Plakaten seinen Untertanen mit der typisch
steifen Armbewegung zu. Immer hÀufiger zeigt er sich in der Tracht des Beduinen oder in der frommen
Verbeugung des Beters. Als Kriegsheld oder gar als Exzentriker mit Tirolerhut lĂ€Ăt er sich kaum noch
feiern. Seine Auftritte in der Ă-ffentlichkeit, die aus SicherheitsgrĂŒnden niemals angekĂŒndigt werden, sind
selten geworden. Er soll jede Nacht in einer anderen Residenz schlafen. Immerhin sah man ihn - inmitten
einer gesiebten Zahl von AnhÀngern - bei der Grundsteinlegung einer Moschee, die im Herzen von
Bagdad entsteht und deren gewaltige AusmaĂe die stolzen Konturen der Moschee Hassans II. von
Casablanca noch ĂŒberragen sollen. Der Rais, so wurde mir mehrfach versichert, wende sich mit
fortschreitendem Alter einem frommen Lebensstil zu, er habe seinen Alkoholkonsum, der frĂŒher erheblich
gewesen sei, stark reduziert.
Im Fernsehen kann man ihn auch bewundern, wie er nach der UN-Vereinbarung »Ă-l fĂŒr Nahrung«, die
dem Irak pro Halbjahr einen Petroleumexport im Gegenwert von zwei Milliarden Dollar erlaubt, mit
energischem Ruck den Verschluà der Pipeline von Kirkuk aufdreht. Noch spektakulÀrer sind seine
sportlichen Darbietungen. Der Diktator - immer noch athletisch gewachsen - stĂŒrzt sich an der Spitze
seiner verschĂŒchterten Getreuen in die Fluten des Tigris, erreicht mit krĂ€ftigen SchwimmstöĂen als erster
das Gegenufer und ĂŒbertrifft mit seiner ungebrochenen physischen Kraft sein Modell Mao Zedong, der zu
Beginn der Kulturrevolution Chinas in den Fluten des Yang Tsekiang gebadet hatte. Irgendwie imponiert
dieser Kraftkerl vom Tigris auch.
Seit dem Desaster von 1991 hat sich sein Charakterbild in der Geschichte allmÀhlich verÀndert.
GewiĂ, selbst in Damaskus, wo PrĂ€sident Hafez-el-Assad - unter dem Zwang der UmstĂ€nde - mit dem
frĂŒheren Todfeind von Bagdad wieder eine diplomatische Normalisierung einleitet, den Handel mit
Mesopotamien aktiviert und auf strategische Vorteile bedacht ist, herrscht immer noch keine positive
Meinung vor.
Ein sehr hoher syrischer Beamter hatte mir unverhohlen erzÀhlt, wie der irakische Staatschef bei gastlichen
EmpfĂ€ngen im Kreise seiner Mitarbeiter und GĂŒnstlinge unversehens die Pistole zieht und einen
vermeintlichen Gegner abknallt, nur weil ihm dessen Auftreten suspekt, der Blick verschlagen erschien.
FĂŒr viele Iraker, die unter dem Boykott der UNO stöhnen, prĂ€sentiert er sich als fĂŒrchterlicher, aber
unbezwingbarer Fels, der der Koalition von dreiĂig Feind-Nationen, angefĂŒhrt durch den KoloĂ USA,
erfolgreich die Stirn geboten hat. Die Legendenbildung sprieĂt im Orient noch ĂŒppiger als andernorts.
Jedenfalls tritt Saddam nicht nur in den Augen seiner Untertanen, sondern auch in der EinschÀtzung vieler
Beobachter des arabischen Auslandes neuerdings in der Rolle des »Batal« auf, des Helden, an dem alle
Komplotte der amerikanisch-zionistischen Verschwörung unrĂŒhmlich zerschellen.
Die Versuche der CIA-Agenten, den Tyrannen vom Tigris auf die eine oder andere Weise zu
liquidieren, sind nur zum geringsten Teil bekannt geworden. Jeder dieser AnschlÀge endete mit einer
fĂŒrchterlichen Blamage. Dank der amerikanischen Presse - die »New York Herald Tribune« brachte eine
umfangreiche Titel-Story - wurde der Riesen-Flop des US-Geheimdienstes im irakischen Kurdistan
wÀhrend des Sommers 1996 in vollem Ausmaà publik. Die Bevölkerung von Bagdad ihrerseits hat sich
weit mehr ĂŒber die konspirativen Eskapaden der Schwiegersöhne des Diktators amĂŒsiert und erregt, die
sich im August 1995 - begleitet von zwei Töchtern Saddams - nach Amman absetzten und den
Amerikanern geheimste RĂŒstungsdaten lieferten. Im GesprĂ€ch bleibt vor allem Hussein Kamil, der als
engster Vertrauensmann des PrĂ€sidenten und schlimmster Henker galt. Die öffentliche VerblĂŒffung war
total, als besagter Schwiegersohn, nachdem man ihm in Bagdad Straffreiheit zugesichert hatte, tatsÀchlich
in die Höhle des Löwen zurĂŒckkehrte und dort - angeblich nicht von den zustĂ€ndigen Staatsorganen,
sondern von Mitgliedern des zutiefst entehrten Familien-Clans - schleunigst umgebracht wurde. Ich habe
gefragt, wie eine solche psychologische Fehlleistung eines intimen Kenners des Regimes ĂŒberhaupt zu
erklÀren sei, und erhielt folgende Antwort: Hussein Kamil stammte aus kleinsten, ja erbÀrmlichen
VerhÀltnissen. Er hatte durch Skrupellosigkeit und Grausamkeit die höchste Gunst des Serail erworben. In
völliger ĂberschĂ€tzung seiner eigenen Bedeutung fĂŒr die amerikanischen Spezialdienste hatte er wohl
gehofft, seinen Schwiegervater an der Spitze des Staates ablösen zu können und selbst PrÀsident zu
werden. SĂ€mtliche irakischen Exil-Politiker jedoch - von den Schiiten bis zu den Kommunisten - wandten
sich mit Abscheu von dieser VerrÀtergestalt ab. Angeblich hat Hussein Kamil - nun auch von seinen »US-Betreuern«
mit MiĂachtung gestraft - sich mit der Bedeutungs- und Mittellosigkeit im Exil nicht abfinden
können. In seiner Verblendung redete er sich ein, sein ehemaliger WohltĂ€ter wĂŒrde doch noch Gnade
walten lassen. Diesen monumentalen Irrtum hat er mit dem Leben bezahlt.
Damit sind die GerĂŒchte nicht zu Ende. Als im Dezember 1996 Udai, der Ă€lteste Sohn Saddam
Husseins, bei einer abendlichen VergnĂŒgungstour am Steuer seines Turbo-Porsche im Stadtkern von
Bagdad durch ein Attentat schwer verletzt wurde, brachte man diesen Ăberfall mit dem Drama Hussein
Kamils und einer Familien-Vendetta in Zusammenhang. Der verwöhnte Playboy Udai war sogar seinem
Vater mit seiner BrutalitÀt, seiner manischen Mordlust lÀstig geworden. Nach mehreren Operationen der
WirbelsĂ€ule tritt der miĂratene SpröĂling, der seine Teil-LĂ€hmung durch wallende Beduinenkleidung zu
verstecken sucht, wieder im Fernsehen auf, um seine fortschreitende Gesundung zu demonstrieren. Dem
Zuschauer fÀllt selbst bei diesen Propaganda-Szenen die VulgaritÀt des Gesichtsausdrucks, das grausame,
erzwungene LĂ€cheln auf.
Bagdad ist in den PrĂŒfungsjahren seiner weltweiten Ăchtung wieder eine zutiefst orientalische,
eine durch und durch islamische Stadt geworden. Die vielen auslÀndischen Handelsvertreter, Ingenieure
und Finanziers - es war nicht immer die Elite des westlichen Unternehmertums - sind verschwunden.
Auch die zahllosen Fremdarbeiter - SĂŒd-Koreaner, Pakistani, Inder, vor allem drei Millionen Ăgypter -haben
den Irak fluchtartig nach der Niederlage von 1991 verlassen oder wurden ohne Entgelt davongejagt.
Geschlossen sind auch die anrĂŒchigen Kasinos und AmĂŒsier-Lokale am Ufer des Tigris. Auf dem
Höhepunkt des Gemetzels an der persischen Front floà dort der Alkohol in Strömen, und die
Kriegsgewinnler starrten gierig auf die zierlichen asiatischen TĂ€nzerinnen aus Bangkok oder Manila, die
sich halbnackt auf der BĂŒhne produzierten, ehe sie mit zahlungskrĂ€ftigen Kunden in ihren Absteigen
verschwanden. Dem Skandal dieses VergnĂŒgungsrummels, der angesichts der fĂŒrchterlichen
Verlustzahlen auf dem Schlachtfeld zum Himmel schrie, wurde abrupt ein Ende bereitet. Die durch das
Embargo bedingte Armut hat es allerdings mit sich gebracht, daĂ heute junge Irakerinnen, oft
Studentinnen, sich als Prostituierte anbieten, um ein bescheidenes Auskommen zu finden.
Die offizielle Entlohnung vom Professor bis zum Hilfsarbeiter - in total entwerteten 250 Dinar-Scheinen
ausgezahlt - bewegt sich zwischen zwei und fĂŒnf Dollar pro Monat, falls man den realen Wechselkurs
zugrunde legt. Es handelt sich um ein symbolisches Entgelt, und wie immer bei solchen extremen
wirtschaftlichen EngpĂ€ssen fragt sich der AuĂenstehende, wie der normale Sterbliche im Irak ĂŒberleben
kann. Die Familienbande sind eben noch intakt, und der Orient ist in dieser Hinsicht manchen Kummer
gewöhnt. Der französische Nahost-Experte Eric Rouleau verweist zu Recht darauf, daà noch kein Land
der Dritten Welt durch Wirtschaftsboykott allein in die Knie gezwungen wurde.
Auf dem GemĂŒsemarkt und im Bazar von Bagdad geht es so lebhaft und lĂ€rmend zu wie zu
Zeiten Sindbads des Seefahrers. Das Angebot an Lebensmitteln ist ĂŒberreich, doch selbst der Preis fĂŒr
Datteln und GrieĂ ist fĂŒr den Durchschnittsverbraucher fast unerschwinglich, ganz zu schweigen vom
Hammelfleisch, das sich nur die Privilegierten leisten können. Viele VerkaufsstÀnde des Suq stehen leer.
Die TextilhÀndler breiten billige Stoffballen aus China auf ihren Regalen aus.
Am schlimmsten ist es um die Medikamente bestellt, weil fast jedes chemische Produkt - dazu zÀhlen
auch DĂŒnge- und Pflanzenschutzmittel - auf der »Roten Liste« steht. Im Irak herrscht keine akute
Hungersnot, aber das Trinkwasser verfault und Infektionskrankheiten breiten sich aus. Ich sollte im
nördlichen Mossul erleben, wie mein Gastgeber, einer der reichsten MÀnner der Stadt, schier verzweifelte,
weil er fĂŒr seinen Vater, der gerade einen schweren Herzanfall erlitten hatte, kein
BlutverdĂŒnnungsprodukt, ja nicht einmal Valium auftreiben konnte. Ăhnlich wie im post-kommunistischen
RuĂland sind im Irak vor allem die Angehörigen des KleinbĂŒrgertums zu bemitleiden.
Mit den kĂŒmmerlichen Resten ihres Besitzes stehen sie als Trödler am StraĂenrand und warten
schicksalsergeben auf einen Interessenten.
Vergeblich habe ich im ganzen Land nach SchmÀhschriften gegen Saddam Hussein Ausschau
gehalten. Daran erkennt man die OmniprĂ€senz der diversen Ăberwachungsdienste - es sind insgesamt
sechzehn - die fast nirgendwo sichtbar in Erscheinung treten, aber die GewĂ€hr dafĂŒr bieten, daĂ jeder
aktive Oppositionelle unverzĂŒglich am Galgen hĂ€ngt. Der Staatschef soll gegenĂŒber den Angehörigen
seines Clans und seiner Sippe nach den letzten EnttÀuschungen wachsenden Argwohn hegen und sich
wieder auf die verschworene Gemeinschaft der alten Baath-GefÀhrten verlassen. Die akute materielle
BedrĂ€ngnis seines Volkes hindert ihn nicht, groĂartige Bauprojekte zu lancieren.
Der neue PrĂ€sidentenpalast ĂŒbertrifft an Pracht und Ausdehnung alle bisherigen Staatsschlösser.
Eine groĂe Ausstellungshalle ist in Auftrag gegeben. Der einst viel geschmĂ€hten Dynastie der
Haschemiten, die hier zu Zeiten des britischen Mandats auf einen wackeligen Thron gehoben wurde, ist
nachtrÀglich - im Zeichen der nationalen Versöhnung - ein ansehnliches Mausoleum errichtet worden. An
die Toten des ersten Golfkrieges gemahnt eine geborstene Kuppel mit grĂŒner Kachelverkleidung. Sie
ersetzt die zahlreichen schwarzen TrauertĂŒcher, die im Sommer 1982 an so vielen HĂ€usern aushĂ€ngen und
auf denen geschrieben stand: »El schuhada akbar minna dschami'an« - »die MÀrtyrer« - gemeint waren
die Gefallenen - »sind gröĂer als wir alle zusammen.«
Der Irak befindet sich in einem eigenartigen Schwebezustand. Da werden mir im engsten
GassengetĂŒmmel jene Verstecke gezeigt, wo - wĂ€hrend des zweiten Golfkrieges - die Sprengköpfe der
Scud-B-Raketen tagsĂŒber in menschenwimmelnder Umgebung gelagert wurden. Die AbschuĂrampen
waren in der WĂŒste verscharrt. Jedes Kind in Bagdad wuĂte um diese hochexplosive PrĂ€senz, aber die
CIA hat davon nie erfahren. Was den Amerikanern, die mit allen Mitteln der Elektronik und des High-Tech
ausgestattet sind, schmerzlich fehlt, ist die sogenannte »human intelligence«, die unersetzbare
AgententÀtigkeit vor Ort. Trotz aller Stimmungsmache gegen die USA, trotz der astronomischen
Reparationsforderungen, die von der gefĂŒgigen UNO eingeklagt werden, stöĂt der westliche AuslĂ€nder auf
keinerlei Feindseligkeit. Die Freundlichkeit der Menschen ist entwaffnend und fast beschÀmend.
Insgeheim - bei allen HaĂtiraden gegen die USA - bewundern ja die Orientalen diese verfluchten
Amerikaner. Viele junge Leute ahmen den Lebensstil nach, soweit die Mittel dazu reichen, und so
mancher trĂ€umt davon, eines Tages in »God's own country« auswandern zu können. Deshalb wĂŒrde ein
abrupter Kurswechsel Washingtons, ein Verzicht auf die kleinliche, die bösartige Diskriminierung und
Auspowerung eines ganzen Volkes vermutlich mit groĂer Erleichterung, ja möglicherweise mit
Versöhnungsangeboten quittiert werden. Das »big business« in den USA kÀme sehr schnell auf seine
Kosten. Die EuropÀer, insbesondere die Deutschen, könnten ganz plötzlich mit ihrer pedantischen
VorschriftserfĂŒllung, ihrer auĂenpolitischen Zaghaftigkeit wie ĂŒberraschte Tölpel dastehen.
Diese etwas heruntergekommene Millionen-Stadt am Tigris hat ihren geheimen Charme. Die
Bessergestellten treffen sich abends in zerfallenen Restaurants am groĂen Strom. Da geht es lĂ€rmend und
nicht sonderlich hygienisch zu. An wackligen Tischen sitzen die MĂ€nner in der weiĂen Dischdascha,
schmauchen ihre Wasserpfeifen, plaudern, spielen Trik-Trak und warten geduldig auf die Zubereitung der
Fische, die ihnen der schweiĂtriefende Wirt eben noch lebend in einem Bassin zur Auswahl gezeigt hat.
Diskret werden Bier und Whisky serviert. Da stört es wenig, daà die Katzen sich um die Fischköpfe
streiten und Scharen von Ratten die Böschung des Stroms erklettern, um sich erwartungsvoll neben die
GĂ€ste zu ducken.
*
Am Nachmittag habe ich mich nach Ktesiphon fahren lassen. Die Besichtigung der antiken Banketthalle,
das gröĂte Rundgewölbe, das je von Menschenhand - dazu noch aus Lehmziegeln - gebaut wurde, lohnt
den Ausflug zur ehemaligen Hauptstadt des Parther- und Sassaniden-Reiches. Dieses Symbol persischen
Widerstandes gegen die römische Allmacht ist nur vierzig Kilometer sĂŒdlich von Bagdad gelegen. Meine
Aufmerksamkeit gilt jedoch vorrangig einem anderen ĂŒberdimensionalen Projekt der jĂŒngsten
Vergangenheit. Etwa auf halber Strecke ist ein riesiges, verwahrlostes Areal durch Stacheldrahtverhaue,
WachtĂŒrme und andere Schikanen abgeschirmt. Dahinter tĂŒrmen sich formlose Lehmhaufen und ein paar
verlassene Baracken.
An dieser Stelle hatte sich die Nuklear-Aufbereitungsanlage »Ozirak« befunden. Hier hatte
Saddam Hussein mit Hilfe französischer Experten den Durchbruch zur Atom-RĂŒstung forcieren wollen.
Die Laboratorien und WerkstĂ€tten waren im zentralen Krater einer kĂŒnstlich aufgeschĂŒtteten Erd-Pyramide
pharaonischen AusmaĂes verborgen und schienen unverwundbar. Dennoch ist es der
israelischen Luftwaffe im Sommer 1981 gelungen, diese unheimliche Waffenschmiede in einem perfekt
inszenierten Ăberraschungsangriff lahmzulegen. Die vernichtende Bombenlast wurde von den
Kampfmaschinen mit dem David-Stern in elliptischer Bahn wie beim Basketball-Wurf oder beim
Granatwerfer-Abschuà ins Ziel gesetzt. Seitdem ist das Terrain gerÀumt, der Witterungserosion
preisgegeben. Der kĂŒnstliche Berg brach in sich zusammen. Im Sommer 1982, bei meiner letzten
Besichtigung, hatte Ozirak trotz der Volltreffer noch einen ganz anderen Anblick geboten. Auf der Höhe
der Sandburg zeichnete sich eine Vielzahl von Flakbatterien und Raketenstellungen ab. Der Himmel
wurde durch knallrote Fesselballons verstellt, als solle die Arbeit bei nÀchster Gelegenheit
wiederaufgenommen werden.
Die Nuklear-Proliferation bleibt das alles beherrschende GesprÀch in den MilitÀrstÀben dieser
Region. Jedermann ist ĂŒberzeugt, daĂ der irakische Rais seine nuklearen Ambitionen - trotz Niederlage
und Sanktionen - nicht aufgesteckt hat. In der Zwischenzeit richten sich die Blicke vornehmlich auf die
Islamische Republik Iran, ĂŒber deren atomare RĂŒstungsvorhaben angeblich prĂ€zise Berichte deutscher
Kundschafter vorliegen. Doch es wÀre nicht das erste Mal, daà den Mullahs und Pasdaran von Teheran
gezielte IrrefĂŒhrungen gelĂ€ngen.
Der lukrative Handel mit angereichertem Plutonium oder miniaturisierten Sprengköpfen aus russischen
oder kasachischen Arsenalen kann jederzeit fĂŒr Ăberraschungen sorgen.
Im Anschluà an den Abstecher nach Ktesiphon haben mir meine beiden Gönner in Bagdad, der
deutsch-irakische Arzt Saad Darwish und der Rektor der alt-ehrwĂŒrdigen Mustansiriyeh-UniversitĂ€t,
Riadel-Dabagh, eine abendliche Rundfahrt durch die Stadt Harun-al-Raschids vorgeschlagen. Gemeinsam
mit dem deutschen Orientalisten Walter Sommerfeld, der sich um die Entzifferung der babylonischen
Keilschrift verdient macht, fördern sie unverdrossen eine »Deutsch-Irakische Gesellschaft« und sind
bemĂŒht, nicht alle FĂ€den Mesopotamiens zur Bundesrepublik abreiĂen zu lassen. »Die gröĂte Gefahr
besteht darin, daĂ die jungen Akademiker aufgrund der drakonischen SanktionsmaĂnahmen von jedem
Kontakt mit dem westlichen Ausland abgeschnitten werden und daĂ sich eine dauerhafte psychologische
Entfremdung einstellte, hatte sich Walter Sommerfeld vor meinem Aufbruch nach Bagdad beklagt.
WĂ€hrend dieses Irak-Aufenthalts werde ich mir durchaus bewuĂt, daĂ ich ein bevorzugtes
»Treatment« genieĂe. Das Informationsministerium hat mir sogar die Erstattung meiner persönlichen
Ausgaben angeboten, was ich natĂŒrlich strikt ablehnte. Dank meiner beiden Betreuer habe ich binnen
kĂŒrzester Frist mit fĂŒnf irakischen Ministern - darunter Tariq Aziz - lange GesprĂ€che fĂŒhren können. Es
wurde mir absolute Reisefreiheit gewÀhrt, und niemand hat versucht, mich mit plumpen Propaganda-Parolen
zu belĂ€stigen. Eine solche LiberalitĂ€t ist um so beachtlicher, als die Bagdader Behörden ĂŒber
meine bisherige Orient-Berichterstattung offenbar gut informiert sind. Sie wissen, daĂ ich im ersten
Golfkrieg engen Kontakt zur militĂ€rischen FĂŒhrung Irans unterhielt und im Februar 1979 mit Ayatollah
Khomeini im gleichen Flugzeug von Paris nach Teheran gekommen war. Auch meine Kommentare zum
Unternehmen »WĂŒstensturm« sind in Bagdad registriert worden. Mit Kritik an Saddam Hussein hatte ich
nie gespart. Doch so klug ist man immerhin in der Umgebung des Rais, daĂ man sich von den nuancierten
Aussagen eines unvoreingenommenen, erfahrenen Beobachters und deren Wirkung auf die deutsche
Ă-ffentlichkeit mehr verspricht als von schön geschminkten Reportagen irgendwelcher »newcomer« in
dieser Region.
Der Abend hat sich ĂŒber das Zweistromland gesenkt. Durch ein unvorstellbares MenschengewĂŒhl
bahnen wir uns den Weg zur schiitischen Moschee von Qadhimain jenseits des Tigris, wo die beiden
Imame Musa-eI-Qadhim und Muhammad-el-Jawad unter Gold und Silber bestattet sind. Saad Darwish
und Riad-el-Dabagh verweisen mich auf die Zunahme der religiösen Inbrunst, die in allen
Bevölkerungsschichten, Sunniten wie Schiiten, bei den Alten und plötzlich auch bei den Jungen
festzustellen ist. Es ist wohl eine Folge der materiellen Not, aber auch der ideologischen Ratlosigkeit.
Arabischer Nationalismus und Sozialismus, die die Baath-Partei - von dem syrischen Christen Michel
Aflaq gegrĂŒndet - einst prĂ€gten, haben eben an GlaubwĂŒrdigkeit und AttraktivitĂ€t verloren. Bleibt der
Islam als geistliche und moralische Zuflucht, als »feste Burg« in einer schwankenden Welt. Hinzu kommt
ein schwindelerregender Bevölkerungszuwachs. »Als wir zur Schule gingen«, berichtet Saad Darwish,
habe er gelernt, daĂ es im Irak fĂŒnf Millionen Einwohner gebe. Im Sommer 1982 wurde mir die Zahl von
dreizehn Millionen Irakern genannt, und heute schÀtzt die UNO die Bevölkerung Mesopotamiens auf
dreiundzwanzig Millionen.
Mit dem Ăberschreiten der Schwelle zur Moschee Qadhimain hat mich die Zauberwelt des
schiitischen Totenkultes aufgenommen. Das GebÀude ist hell angestrahlt, leuchtet mit seiner riesigen
Goldkuppel wie ein Juwel in der Dunkelheit unter dem Halbmond. Die Menge der Frommen umkreist
dichtgedrÀngt die Sarkophage ihrer heiligen MÀrtyrer. Sie klammern sich segenheischend an das schwere
Silbergitter, sinken in schluchzender Trauer vor den massiven Goldtafeln der Grabkammer nieder. Die
zahllosen Spiegelfacetten, die mit leuchtenden Kaskaden die Illusion von Jenseitigkeit vermitteln, wĂŒrden
an anderer Stelle kitschig wirken. Hier schimmern sie wie ein StĂŒck Paradies. Es ist stets das gleiche,
magische Dekorationsmuster, das die »Partei Alis« zur Ehrung ihrer Imame aufbietet. Ăhnlich glitzern die
Grabeshöhlen von Meschhed und Qom, von Kerbela, Nedschef und Samara, wo der Zwölfte der
AuserwÀhlten, »Mehdi« genannt, sich seinen sunnitischen Verfolgern durch die Flucht in die
»Verborgenheit« entzog. Aus dieser Okkultation, so lautet der Glaube, wird der Zwölfte Imam, der »Herr
der Zeiten« eines Tages wiederkehren, um das Reich Gottes und der Gerechtigkeit zu errichten. Der
Messianismus ist nicht auf das Judentum beschrĂ€nkt. Warum spĂŒre ich an diesem Abend die Faszination
der schiitischen Klage- und Trauergemeinde besonders intensiv? Warum entsinne ich mich plötzlich in
aller Deutlichkeit der Hafenstadt Khorramshahr am Schatt-el-Arab, die von den Irakern nach kurzfristiger
Eroberung plattgewalzt worden war. »Ya Allah« - stand dort auf einer Banderole, die den Mihrab einer
zerschossenen Moschee verdeckte: »Oh Allah, erhalte uns Ruhollah Khomeini bis zur Revolution des
Imam Mehdi - hatta el thaura el Imam el Mehdi!« Nicht als Erlöser, sondern als RevolutionÀr wird der
Zwölfte Imam seine Parusie vollziehen.
Saad Darwish schĂ€tzt den schiitischen Bevölkerungsanteil von Bagdad auf fĂŒnfzig Prozent. Er
zeigt mir auch das Mausoleum des Scheikh Abu Hanifa, des GrĂŒnders der weit verbreiteten hanefitischen
Rechtsschule oder »Madhhab« der Sunniten. Doch diese GedenkstÀtte wird kaum besucht. Ich frage den
Rektor der Mustansiriyeh-UniversitÀt nach dem mittelalterlichen Mystiker El Halladsch, der zur Zeit der
Abbassiden gekreuzigt und in StĂŒcke gerissen wurde, weil er mit blasphemischer Arroganz behauptet
hatte: »Ana el haq - ich bin die Wahrheit«. Riad-el-Dabagh Ă€uĂert seine Verwunderung. »Ich weiĂ, daĂ
dieser Exzentriker im Westen, vor allem bei den deutschen Orientalisten, eine erstaunliche Bewunderung
genieĂt, fast zur Kultfigur der deutschen Sufi geworden ist. Hier in Bagdad spielt er keine Rolle, hat sie
auch nie gespielt. Das Volk hat sogar seinen Namen vergessene Ăhnlich verhalte es sich ja mit anderen
muslimischen Mystikern, GrĂŒndern von Derwisch-Orden oder »Tariqat«, die im Abendland aufgrund
ihrer Beteuerungen der kosmischen Liebe, der »Mahabba«, in pantheistisch anmutender Abweichung
vom Koran als ReprÀsentanten eines alles verzeihenden, alles erduldenden »Herz-Jesu-Islam« stilisiert
wĂŒrden. Dabei hatten die Bedeutendsten unter ihnen doch nur die »Ruhe in Gott« gesucht, um dann »auf
dem Wege Allahs« um so wackerer streiten zu können. »Nur Narren können den Quietismus dieser
islamischen Vordenker mit Pazifismus gleichsetzen«, sagt der Rektor. »Im Gegenteil, die Inspiratoren
dieser religiösen MĂ€nnerbĂŒnde - von den schiitischen Safawiden, den sunnitischen Naqschbandi bis zu
den Senussi der Neuzeit - haben unvermeidlich zum Heiligen Krieg gegen die UnglÀubigen aufgerufene
Was konnte die strikte, auf das ungeschaffene Wort Allahs festgelegte Deutung des Koran durch die
Ulama mit der Aussage eines AuĂenseiters anfangen, der sich anmaĂte, die göttliche Wahrheit zu
verkörpern. »Quid est veritas? - Was ist die Wahrheit?« hatte schon der ratlose Pro-Consul Pontius Pilatus
einen angeblichen »Rex ludaeorum« gefragt, der von sich selbst sagte: »Ich bin die Wahrheit und das
Leben.«
Mein wirkliches Eindringen in die geistlichen AbgrĂŒnde des Orients findet erst am folgenden Tag
statt. Von weit her leuchtet das auf Isfahan verweisende, farbenprÀchtige Blumenornament einer
wunderschönen Kuppel ĂŒber dem alten Stadtkern von Bagdad. Sie schwebt ĂŒber dem Wallfahrtsort des
Scheikh Abd-eI-Qadir-el-Keilani, der im zwölften Jahrhundert am Tigris seine JĂŒnger, seine »Muriden«,
um sich sammelte. Dröhnende PaukenschlÀge hallen durch die Nacht.
WeiĂgekleidete, ĂŒberwiegend mĂ€nnliche Beter strömen von allen Seiten - zu FuĂ, in Bussen, in Taxis -zum
GedĂ€chtnisritual. Der Geburtstag des GrĂŒnders der Qadiriya-Bruderschaft, eine fast
weltumspannende Tariqat des sunnitischen Islam, wird wie ein Volksfest und - je geheimnisvoller die
DĂ€mmerung sich senkt - als exotisches Mysterienspiel gefeiert. Dieses Mal haben zahlreiche Soldaten der
Republikanischen Garde die Sicherung ĂŒbernommen. Sie tragen Tarnuniform und ein rotes Barett. Die
Kalaschnikow halten sie schuĂbereit auf der HĂŒfte. Gemeinsam mit dem Arzt Darwish drĂ€nge ich mich
ins GewĂŒhl, und niemand scheint Notiz von dem UnglĂ€ubigen zu nehmen. Es herrscht eine verwirrende,
kollektive Erregung. Mit einem Schlag fĂŒhle ich mich in eine irreale Welt versetzt, in eine andere Epoche
der Menschheit. Ekstatischer Rausch bemĂ€chtigt sich der jungen bĂ€rtigen MĂ€nner in schneeweiĂer
Dischdascha. Viele tragen einen Fez mit Stickereien auf dem Kopf. Auch Kurden - an ihrer Tracht zu
erkennen - sind zahlreich vertreten.
Gleich nach ihrer Ankunft bilden die Beter einen Doppelkreis, dessen TĂ€nzer sich in
entgegengesetzter Richtung bewegen. Die Pauken geben den Rhythmus dieses zunehmend schnellen
Reigens an. Ăber den Köpfen schwenken die Muriden grĂŒne Fahnen, und aus ihren Kehlen dringt die
unaufhörlich wiederholte Beteuerung: »La illaha illa Allah - es gibt keinen Gott auĂer Gott!« Diese Ăbung
des »Dhikr« habe ich in fast identischer Form in ganz anderen Weltgegenden - auch in Schwarzafrika -bereits
erlebt. Doch die eindrucksvollste Begegnung hat vor genau einem Jahr - der Krieg gegen die
Russen war noch im Gange - in Tschetschenien stattgefunden. In den Dörfern rund um Grosny waren die
kaukasischen Krieger zum selben Ritual, zum Klang des gleichen Glaubensbekenntnisses und dröhnender
Trommeln zusammengekommen, hatten den wirbelnden Ring zu Ehren Allahs geschlossen und die grĂŒne
Fahne des Propheten hochgehalten, die zusÀtzlich mit dem Totem-Tier der Tschetschenen, dem grauen
Wolf, geschmĂŒckt war. In der westlichen Berichterstattung ist kaum einem Reporter aufgefallen, daĂ der
Widerstand der Kaukasier gegen RuĂland - wie schon zu Zeiten des Imam Schamil - sich mehr noch aus
dem Geist des Koran als aus dem nationalen Instinkt dieser Bergvölker nĂ€hrte. Die GeheimbĂŒnde, die
Tariqat, die geistlichen Derwisch-Orden, hatten dem Islam erlaubt, die siebzigjÀhrige von den
Kommunisten verordnete Gottlosigkeit zu ĂŒberleben und nach dem Zerfall des Sowjet-Imperiums
plötzlich wieder prĂ€sent zu sein. In der TĂŒrkei war die sĂ€kulare Islam-Feindlichkeit des Kemalismus auf
den gleichen unterirdischen Widerstand gestoĂen. Auch dort fanden die Muriden unmittelbar nach dem
Tod AtatĂŒrks zur ReligiositĂ€t der VĂ€ter zurĂŒck. Die Tschetschenen gehören mehrheitlich der »Qadiriya«
an, so hatten sie mir versichert. Sie waren Gefolgsleute des Scheikh Abd-eI-Qadir-el-Keilani aus Bagdad,
vor dessen Grab ich nun stehe.
Im Unterschied zu den relativ nĂŒchternen GebetsĂŒbungen im Kaukasus ist hier gleich von Anfang
an eine exaltierte Stimmung aufgekommen. Neben mir geraten mehrere junge MĂ€nner in Trance, winden
sich wie Epileptiker, verfallen in krampfartige Zuckungen und werden von ihren GefÀhrten festgehalten.
»Je weiter die Nacht fortschreitet, desto intensiver wird sich dieser Zustand der VerzĂŒckung der feiernden
Qadiri bemĂ€chtigen, kommentiert Saad Darwish. Er bedauert, daĂ er mich aus ZeitgrĂŒnden nicht zu einer
sakralen Zusammenkunft der »Rifaiya«-Sekte mitnehmen kann. Es fÀllt schwer, den Rifai, die sich wie
hinduistische Fakire auffĂŒhren, den Titel von Muriden, von »Gottsuchern«, zuzuerkennen. Bei den
Gauklern der Rifaiya-Gemeinschaft wird die pseudo-religiöse Halluzination so weit getrieben, daĂ
frömmelnde Exhibitionisten sich - nach Erreichung des Trance-Zustandes - Messer in den SchÀdel
rammen, sich von SÀbeln durchbohren lassen und Neonröhren schlucken. Diese Beleuchtungskörper, die
angeblich eine besondere Anziehungskraft auf das MarterbedĂŒrfnis der Sektierer ausĂŒben, werden wie
Leckerbissen zerkaut.
Die geschilderten Extravaganzen sind durch Photos, Filmaufnahmen und auch durch das Zeugnis des
nĂŒchternen Professors Sommerfeld belegt, der - wie er mir erzĂ€hlte - einen dieser TollwĂŒtigen an der
Schulter festhielt, wÀhrend eine stÀhlerne Stange in seinen Brustkorb eindrang.
Die deutschen Sufi-Bewunderer sind sich wohl nicht bewuĂt, zu welcher Scharlatanerie die
mystische »Weltliebe« ihrer hehren islamischen Vorbilder bei den heutigen Derwischen allzuoft
verkommen ist.
Selbst das touristisch ausgerichtete Spektakel der tanzenden Derwische von Konya hat nur noch wenig
mit der tiefgrĂŒndigen Meditation des Meisters Dschallal-el-Din-el-Rumi zu tun. Wer ist schon zugegen,
wenn die DrehĂŒbungen dieser »Mönche« sich - fern von fremden Blicken - zum unertrĂ€glichen Delirium
steigern? Die nĂŒchternen »Fundamentalisten« wollen mit diesen obskurantistischen
Degenerationserscheinungen des Glaubens aufrĂ€umen und zur koranischen Reinheit zurĂŒckfĂŒhren. Da ist
das individuelle »Ruhen in Gott« nur im engen Rahmen der anerkannten Offenbarung erlaubt. Der
»Idschtihad« wird auf die Interpretation des Koran und des »Hadith« begrenzt. »Alles steht im Koran«, so
lautet die Losung, und das Treiben der Sufi gerÀt - wie zu Zeiten des Ibn Taimiya - in den Verdacht der
strÀflichen Glaubensabweichung.
Vermutlich ist diese rigorose Verwertung des »Tariqa-Wesens« durch die Fundamentalisten und
Integristen ein entscheidender Grund fĂŒr die erstaunliche Toleranz, die Saddam Hussein und so manch
anderes Staatsoberhaupt des Dar-ul-Islam - ich denke dabei insbesondere an Islam Karimow in
Usbekistan - den AktivitĂ€ten der Derwisch-BĂŒnde entgegenbringen. Mit Hilfe dieser volksverbundenen
Wirrköpfe möchte der Rais von Bagdad das Hochkommen jener unerbittlichen Rigoristen verhindern oder
zumindest hinauszögern, in deren Idealstaat kein Platz mehr wĂ€re fĂŒr sein sĂ€kulares Baath-Regime und fĂŒr
die religionsfremde WillkĂŒr seiner MachtausĂŒbung.
Am Rande vermerkt sei die Tatsache, daĂ israelische Propagandisten, wenn sie in gezielten
Filmproduktionen die religiösen Eiferer von Hamas diskreditieren wollen, mit Vorliebe auf die
Gruselbilder rasender »Pseudo-Fakire« zurĂŒckgreifen. Dabei unterstellen sie, daĂ solche Exzesse bei den
koranischen Erneuerungsbewegungen gang und gĂ€be seien. Das Gegenteil ist der Fall. FĂŒr den
Spezialisten eröffnet sich hier ein interessantes Beobachtungsfeld: Wie wird es den islamischen Puristen,
den AnhÀngern der »Salafiya«, die in den streng koranischen Bewegungen PalÀstinas, Algeriens,
Ăgyptens, Afghanistans, PalĂ€stinas und der TĂŒrkei den Ton angeben, am Ende gelingen, mit den
altehrwĂŒrdigen Erscheinungsformen des Volks-Islam - ich denke hierbei nicht an dessen groteske
AuswĂŒchse - fertig zu werden? Wie wollen sie die weitverzweigten MĂ€nnerbĂŒnde der Tariqat integrieren
und auf ihre religiöse Linie bringen? Dieses Problem wird sich zumal in den jungen islamischen
Republiken der einstigen Sowjetunion stellen.
Mit dem Namen des hochverehrten Scheikh Abd-el-Qadir-el-Keilani verbindet sich die
Erinnerung an eine kuriose Episode des Zweiten Weltkrieges. Ein direkter Nachfahre dieses heiligen
Mannes, Raschid-el-Keilani, hatte sich als arabischer Nationalist und Gegner der britischen Mandatsmacht
auf die Seite GroĂ-Deutschlands geschlagen. Er war der ideologische Inspirator jener MilitĂ€rrevolte, die im
FrĂŒhjahr 1941 vorĂŒbergehend die Macht in Bagdad an sich riĂ und ein BĂŒndnis mit den AchsenmĂ€chten
einging. Diese antibritische Erhebung fĂŒgte sich in den paranoid anmutenden Eroberungsplan Hitlers ein,
der ĂŒber Ăgypten und die Levante einerseits, den Kaukasus andererseits seine Armeen so weit nach Asien
vertreiben wollte, bis sie sich in Indien mit den japanischen Soldaten des Tenno treffen wĂŒrden. In einer
ersten Phase lieĂ sich dieses grandiose Projekt sogar recht gĂŒnstig an: Im französischen Mandatsgebiet
Syrien und Libanon behauptete sich der Vichy und PĂ©tain ergebene General Dentz gegen eine Minderheit
von Gaullisten. In Ăgypten stand Erwin Rommel mit seinem Afrikakorps bei El Alamein vor den Toren
Kairos. Im Kaukasus hatten deutsche GebirgsjĂ€ger die Reichskriegsflagge auf dem Elbrus gehiĂt und
drÀngten zum Kaspischen Meer.
Doch der britische Löwe kannte sich aus im WĂŒstensand Arabiens. Einige Regimenter des
Empire, unterstĂŒtzt durch einen Trupp »Freier Franzosen« und israelische Haganah-KĂ€mpfer - darunter
Moshe Dayan, der dabei ein Auge verlor -, zwangen General Dentz in Damaskus zur Kapitulation. Gegen
den Iraker Raschid-el-Keilani wurde die »Arabische Legion« des Emirats Transjordanien unter dem
Befehl des EnglĂ€nders Glubb Pascha in Bewegung gesetzt. Diese vorzĂŒglich gedrillte Beduinen-Einheit
setzte dem Treiben der arabischen Nationalisten am Tigris ein jÀhes Ende und hob dort die pro-britische
Dynastie der Haschemiten wieder in den Sattel. Vor den »Glubb-Girls«, wie man sie ihrer malerischen
Tracht wegen nannte, muĂte Raschid-el-Keilani ĂŒber die TĂŒrkei nach Berlin flĂŒchten. Nach dem Krieg ist
er in seine Heimat zurĂŒckgekehrt und als angesehener Patriot gestorben.
US-Protektorat Kuweit
Kuweit, im Februar 1997
Die irakischen Behörden konnten aus meinem Paà ersehen, daà ich im Februar 1997 das Scheikhtum
Kuweit aufgesucht hatte. Aber niemand hat mir eine Frage gestellt nach den aktuellen ZustÀnden in
diesem Nachbarland, das vorĂŒbergehend als neunzehnte Provinz des Irak annektiert worden war.
Niemand schien sich fĂŒr die artifizielle Staatskonstruktion zu interessieren, die eine so disproportionierte
internationale Bedeutung gewonnen hatte.
Aus dieser jĂŒngsten Erfahrung fĂ€llt mein Urteil ĂŒber Kuweit noch negativer aus, als es vor dem
Golfkrieg ohnehin schon war. FĂŒr die Erhaltung des Mini-Gebildes am nördlichen Ende des Persischen
Meerbusens, das von Anfang an auf Lug und Trug gebaut war, ist die halbe Welt in die Bresche
gesprungen. GewiĂ, der irakische Ăberfall auf das Scheikhtum hatte dem Westen kaum Alternativen
gelassen. Doch an dem gigantischen Einsatz der Operation »Desert Storm« gemessen, war das Ergebnis
zutiefst deprimierend. Alles erschien nunmehr doppelt hohl und gekĂŒnstelt. Das prĂ€tentiöse Gehabe der
einheimischen Ă-l-Barone, die sich als Beduinen kostĂŒmierten wie auf einem Faschingsball, kontrastierte
mit der UnterwĂŒrfigkeit ihrer Fronarbeiter aus Indien und SĂŒdostasien, die drei Viertel der Bevölkerung
ausmachten. Als WĂŒsten-Nomaden waren die Vorfahren des heutigen Herrscherhauses El Sabah einst aus
der Einöde des Nedschd gekommen. Damals war die »PiratenkĂŒste« nur wegen ihrer barbarischen
RĂŒckstĂ€ndigkeit und ihrer Perlenfischerei bekannt. Diese Eroberer aus dem Nichts waren im
Handumdrehen zu Marionetten GroĂbritanniens, dann zu Handlangern der USA geworden. Ihren
unermeĂlichen Petroleum-Reichtum hĂ€tten die Kuweiti ohne die Ankunft amerikanischer Prospektoren
ĂŒberhaupt nicht wahrgenommen. Jetzt saĂen diese Usurpatoren in ihren vergoldeten Prunksesseln - Stil-Epoche
»Louis XV.« - wie fette, kastrierte Kater auf ihren riesigen Vermögen.
Ohne die wallende Dischdascha, die goldgerandete Abayah und das weiĂe, feierliche Kopftuch wĂŒrde
man sie auf den ersten Blick als Hinterhof-Bazari entlarven.
Es lohnt sich kaum, die seltenen GesprÀche wiederzugeben, die ich mit diesen opportunistischen
NutznieĂern des »Schwarzen Goldes« fĂŒhren konnte. »Die USA sind allmĂ€chtige, tönte es da, »PrĂ€sident
Clinton wird den Friedensprozeà in PalÀstina schon erzwingen. Die US Navy beherrscht den Golf, und
dagegen hat niemand eine Chance.« Die Kontakte zu Kaufleuten aus der schiitischen Minderheit - sie
macht ungefĂ€hr dreiĂig Prozent der Staatsangehörigen mit kuweitischem PaĂ aus - waren etwas
aufschluĂreicher. »Ob Saddam Hussein stĂŒrzt oder nicht«, wurde mir da anvertraut, »die Baath-Partei
wird in Bagdad an der Macht bleiben und mit den gleichen Methoden weiterregieren. « - »Die Amerikaner
werden das Embargo gegen den Irak sofort aufheben, wenn ihnen Saddam Hussein die volle Nutzung
seiner Energie-Vorkommen zusichert, ihnen den gröĂten Anteil am Kuchen lĂ€Ăt.« Eine solche Perspektive
beunruhigte den Herrscher Salehel-Jaber-el-Sabah und dessen Familien-Clan, denn das Zweistromland
besitzt mit 112 Milliarden Barrel Rohöl die bislang zweitgröĂten Petroleum-Reserven der Welt, und in den
vergangenen Jahren hatten die Feinde Bagdads das irakische OPEC-Kontingent, das durch das Embargo
blockiert war, lukrativ untereinander aufgeteilt. Am Rande erfuhr ich, daĂ - bis zur UN-Resolution 986, die
den Rahmen fĂŒr das Abkommen »Oil for food« festlegte - ausschlieĂlich das Königreich Jordanien ĂŒber
eine von den Vereinten Nationen genehmigte Importquote irakischen Ă-ls verfĂŒgte und diese Lizenz
benutzte, Schwarzmarkt-Lieferungen von tĂ€glich 20000 Barrel preisgĂŒnstig an Israel zu verhökern.
Ich neige nicht zu tugendhafter EntrĂŒstung. DafĂŒr habe ich in allzu vielen LĂ€ndern allzu
SchÀndliches beobachtet und erlebt. Aber der Gedanke, daà das Scheikhtum Kuweit nunmehr die »Neue
Ordnung« fĂŒr den Mittleren Osten verkörpern, gewissermaĂen als Leuchtturm der Pax Americana
herhalten soll, wirkt unertrĂ€glich. FĂŒr diese Schmarotzer amerikanischer Macht lohnte es sich wahrhaftig
nicht, die Knochen eines einzigen pommerschen, kalifornischen oder bretonischen Grenadiers zu
riskieren. FĂŒr die StreitkrĂ€fte Kuweits, fĂŒr Armee und Nationalgarde, waren - wie in den anderen Emiraten
der PiratenkĂŒste - auslĂ€ndische Söldner, ĂŒberwiegend Pakistani, angeworben worden. Der Kampfwert der
Truppe ist extrem niedrig, obwohl sie von der US-RĂŒstungsindustrie mit modernstem und teuerstem
Kriegsmaterial ĂŒberschĂŒttet wird. Wehe, wenn der kleine SchĂŒtzling ausnahmsweise ein paar Haubitzen
bei der Volksrepublik China bestellt mit dem Hinweis, Peking habe sich wÀhrend des Golfkrieges im
Weltsicherheitsrat doch sehr kooperativ verhalten. Der Zorn des US Congress pocht dann unerbittlich an
die Pforten der El Sabah-PalÀste.
Es wĂ€re mĂŒĂig, die scheindemokratische Fassade des Emirats auf irgendeinen Wirklichkeitswert
abzuklopfen. Gelegentlich wird in den bestechlichen Presse-Erzeugnissen Kuweits ĂŒber die EinfĂŒhrung
der koranischen Rechtsprechung diskutiert. In Wahrheit geben die Stammesstrukturen, die Clan- und
Familienbande weiterhin den Ausschlag. Amerikanische Waffen werden in den WĂŒstendepots in HĂŒlle
und FĂŒlle gelagert, um den Marines und Luftlandetruppen eine sofortige Interventions-Entfaltung im
nördlichen und östlichen Grenzstreifen zu erlauben.
Schon am zweiten Tag habe ich ein komfortables Auto gemietet. In Begleitung eines
dunkelhÀutigen Tamilen-Chauffeurs aus Sri-Lanka habe ich das Schlachtfeld von 1991, den verlustreichen
RĂŒckzugsweg der irakischen Divisionen besichtigt. Die glĂ€sernen HochhĂ€user, die kĂŒnstlichen
GrĂŒnanlagen und Shopping Malls von Kuweit-City lagen bald hinter uns. Die wahre Landschaft nahm uns
auf, eine schmutziggelbe WĂŒste. Hier und dort wuchs graues GestrĂŒpp, dann drĂ€ngten sich groĂe Herden
schwarzer Kamele an das kĂŒmmerliche Futter.
Noch nie war mir die saurierÀhnliche Form des Dromedar-Kopfes so deutlich aufgefallen. Vor einem
Kraftwerk mit vier gigantischen KĂŒhltĂŒrmen kauerten Beduinenzelte in der Ă-de. Daneben parkten
fahrbare WasserbehÀlter, ohne die die Nomaden von heute nicht mehr auskommen. Rundum waren
PlastiktĂŒten und leere KonservenbĂŒchsen verstreut. Das perfektionierte Sicherheitssystem eines
umfangreichen Compounds signalisierte die PrĂ€senz einer amerikanischen Armee-Einheit. DarĂŒber
schwebte zu Beobachtungszwecken ein knallroter Fesselballon.
Je weiter wir uns nach Norden bewegten, desto einsamer und dĂŒsterer dehnte sich die SandflĂ€che.
Es war ein nebliger Tag. Am Horizont ballten sich Wolken wie Atompilze. Der sympathische, höfliche
Tamile machte mich auf eine langgestreckte HĂŒgelkette, die »Mutla-Ridge«, aufmerksam, der wir
nunmehr folgten. »Hier lagen nach dem Krieg Tausende irakischer Fahrzeuge und Panzer im Sand. An
dieser Stelle haben die Iraker auf ihrer heillosen Flucht die schwersten Verluste erlitten.« Das zerstörte
Material ist abgerÀumt worden. Keinerlei Waffenschrott war mehr zu entdecken. Nur ein paar
Stacheldrahtverhaue mit roten Dreieck-Schildern warnten vor Minen.
Zur Rechten dehnte sich die zementgraue Wassermasse des Golfs. Ich hatte als Reiseziel die Insel
Bubiyan angegeben. Eine weitgeschwungene, kilometerlange BrĂŒcke setzte zu diesem flachen Eiland ĂŒber.
Der Boden dort soll mit Petroleum getrÀnkt sein. Der Territorialstreit zwischen Bagdad und Kuweit ist in
diesem Winkel noch keineswegs beigelegt. Die BrĂŒcke war an zwei Stellen gesprengt. Am Ufer verfaulte
das Wrack eines muschelverkrusteten Fischerbootes. Eine arabische Inschrift untersagte die AnnÀherung.
Ein paar zerbombte BetonhĂŒtten hatten Squatter angezogen: Beduinen, die sich an einem fahrbaren
Verkaufsstand mit billigen Gebrauchswaren eindeckten, und Fremdarbeiter aus der nahen Industriezone.
Letztere stammten mehrheitlich aus Bangladesch. Mein Chauffeur unterhielt sich kurz mit ihnen. »Wir
haben uns auf Hindi verstÀndigte, beantwortete er meine Frage.
Wir bogen nach Norden ab, in Richtung irakische Grenze. Die Beklemmung unter dem schweflig
gelben Himmel nahm noch zu. Ein kalter Wind war aufgekommen. Die Asphalt-Piste nach Umm-el-Qasr,
dem irakischen Hafen am Eingang des Schatt-el-Arab, wurde nachlÀssig von Blauhelmen der
Waffenstillstands-Organisation UNIKOM ĂŒberwacht. »United Nations Kuwait Observation Mission«,
heiĂt das im Klartext. Die Soldaten stammten aus aller Herren LĂ€nder. FĂŒr die Staaten der Dritten Welt ist
die Truppen-Entsendung im Dienst der Vereinten Nationen ein eintrÀgliches GeschÀft. Der weitaus
gröĂere Teil des stattlichen Wehrsoldes wird von den Heimatbehörden einbehalten, aber fĂŒr die
Muschkoten aus diesen meist bettelarmen Gegenden lohnt sich der langweilige Dienst immer noch, zumal
der Schwarzhandel blĂŒht. Sie kampierten unter weiĂen Zelten. Viele Stellungen waren verlassen und zur
HĂ€lfte vom WĂŒstensand bedeckt. Ganz in der Ferne konnte ich mit dem Feldstecher ein paar GerĂŒste,
einen Sendemast, die LadekrÀne des irakischen Hafens Umm-eI-Qasr entdecken. So nah war das Reich
Saddam Husseins. WĂ€hrend des ersten Golfkrieges war Umm-el-Qasr vorĂŒbergehend von den persischen
Pasdaran erobert worden. Sie wichen erst zurĂŒck, als sie im Giftgas der Iraker zu ersticken drohten. Der
Tamile gab mir zu verstehen, daĂ er nicht weiterfahren durfte.
Wie gern hÀtte ich diesen Ausflug fortgesetzt. Nur eine relativ kurze Entfernung trennte uns ja von
dem immer noch eindrucksvollen »Ziggurat« und den KönigsgrÀbern, die letzte Kunde von dem uralten
Herrschaftssitz Ur in ChaldÀa geben. In diesem Raum war der Patriarch Abraham geboren worden, den
die Muslime als »Hanif« verehren. Hier wurde dem Erzvater die erste Offenbarung zuteil von der Existenz
des einzigen Gottes, der keine Götzen neben sich duldet, eines himmlischen Alleinherrschers und
Erbarmers, der weder ergrĂŒndet noch dargestellt werden darf. Dieser Durchbruch zum Monotheismus war
eine Schicksalsstunde in der Geistesgeschichte der frĂŒhen Menschheit, die bislang in Verehrung und
Furcht vor einem PandÀmonium tierÀhnlicher Idole, blutgieriger Monster oder ausschweifender
Fruchtbarkeitssymbole dahindÀmmerte. Eine solche Erleuchtung konnte wohl nur in der asketischen
Einsamkeit der WĂŒste und ihrer mineralischen Unendlichkeit aufkommen.
Ich warf noch einen Blick auf die Insel Bubiyan, auf die Traurigkeit dieses »letzten Ufers« an
einem Meer, das zu Blei erstarrt schien. Die blaue UNO-Fahne und die grĂŒn-weiĂ-rote Trikolore Kuweits
mit dem schwarzen Dreieck bildeten die einzigen Farbtupfer. An den zerschossenen HÀuserwÀnden von
El Mutla entzifferte ich mĂŒhsam ein paar Inschriften. Sie waren politisch bedeutungslos, priesen die GröĂe
Allahs und seines Propheten. Dabei kam mir eine Episode aus dem Herbst 1956 in den Sinn. Der kurze
Offensiv-Krieg der EnglÀnder, Franzosen und Israeli am Suez-Kanal war noch im Gange; die Alliierten
rĂŒckten auf Ismailia vor und der Ă€gyptische Widerstand brach zusammen. Da hatten die pan-arabischen
Nationalisten, unentwegte ParteigÀnger Gamal Abdel Nassers im Libanon, eine trotzige Parole an die
Mauern von Saida, Tyros und Tripoli gepinselt: »La tantahi ma'rakat el qanat - der Krieg um den Kanal ist
noch nicht zu Ende.« Wenige Tage spÀter sollten sie recht behalten. Die Invasions-Truppen der Entente-MÀchte
und Israels wurden durch massive Drohungen Washingtons und Moskaus zum RĂŒckzug
gezwungen. Am liebsten wÀre ich am tristen Meeresstrand von Kuweit aus dem Auto gestiegen und hÀtte
in groĂen Lettern eine Ă€hnlich lautende Mahnung in den Sand gemalt: »La tantahi ma'rakat el khalidsch -der
Krieg um den Golf ist noch nicht zu Ende.«
gesamter Thread:
 Mix-Ansicht
Mix-Ansicht