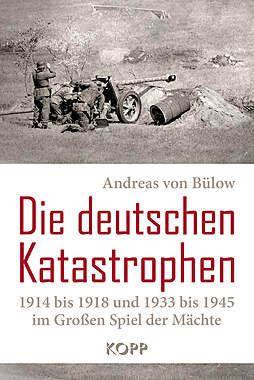-->>... und nat├╝rlich ein frohes neues Jahr an alle... und herzlichste Gl├╝ckw├╝nsche an den Betreiber des Forums!
>Nice week,
>Zardoz
Es ist Zeit f├╝r Schwarz-Gr├╝n, stellt
der Gr├╝nenpolitiker Oswald
Metzger fest
Es ist Zeit f├╝r eine schwarz-gr├╝ne Koalition / Von Oswald
Metzger
Ich bekenne, schon f├╝r schwarz-gr├╝ne Allianzen geworben
zu haben, als Helmut Kohl noch Kanzler war. Als
Wiederholungst├Ąter behaupte ich heute frecher denn je:
Schwarz-Gr├╝n ist nicht einfach eine politisch-strategische
Option, die uns Gr├╝ne aus den Klauen einer etatistischen SPD
samt allen orthodoxen Besitzstandswahrern in deren Dunstkreis
befreien kann. Schwarz-Gr├╝n symbolisiert das Aufbrechen von
Tabus, versinnbildlicht die Bereitschaft, im Interesse der
dringend notwendigen gesellschaftlichen Erneuerung aus den
eingefahrenen Pfaden des politischen Establishments
auszubrechen.
(Partei-)Politik samt ihrer medialen Vermittlung funktioniert bei
uns fast immer in Form von Abgrenzung. Kommt ein
Vorschlag von der falschen Seite, wird er grunds├Ątzlich
abgelehnt. Der Abwehrreflex ist so verinnerlicht, auch in der
Wahrnehmung der ├â-ffentlichkeit, da├č Politiker, die keine
Scheuklappen tragen und ├╝ber Parteigrenzen hinweg
Probleml├Âsungen debattieren wollen, Freund und Feind suspekt
sind. Ein Politiker hat sich gef├Ąlligst an die oberste Spielregel zu
halten: Die eigene Partei hat immer recht, auch wenn sie nicht
recht hat. Und die Konkurrenz hat immer unrecht, selbst wenn
sie recht hat. Die Folgen dieser parteipolitischen Untugend sind
auch an der Reformunf├Ąhigkeit unserer sozialen
Sicherungssysteme abzulesen - egal, wer in den vergangenen
Jahrzehnten in Bonn/Berlin regierte.
Journalisten aller Couleur spielen dieses fatale Abgrenzungsspiel
aus Blockade und Selbstblockade mit, ersparen sie sich doch
damit - genau wie Politiker - die fundierte Auseinandersetzung
mit den Inhalten von Vorschl├Ągen. Wer raus aus den
gewohnten Bahnen will, mu├č Substanz haben, fachlich und
charakterlich.
Wenn man diese Ma├čst├Ąbe an das Verh├Ąltnis der Gr├╝nen zur
Union legt, dann haben die Gr├╝nen weder Substanz noch
Charakter. Denn jedesmal, wenn die Diskussion hochkam, im
eigenen Beritt oder in j├╝ngster Vergangenheit aus der Union,
hie├č es aus der gr├╝nen F├╝hrung penetrant: Mit denen nicht! Die
schicken die Frauen wieder an den Herd, Ausl├Ąnder am liebsten
nach Hause und bekriegen alles, was uns Gr├╝nen als Symbol
gesellschaftlicher Erneuerung gilt: modernes Abtreibungsrecht,
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften,
Zuwanderungsgesetz. Und wenn das nicht reichte, fielen
Namen: Helmut Kohl, Erwin Teufel, Edmund Stoiber, Roland
Koch.
Fast krampfhaft mu├čten sich die Gr├╝nen von der Union
abgrenzen, weil viele aus der gr├╝nen Gr├╝ndungsgeneration aus
konservativen b├╝rgerlichen Familien kamen, mit denen sie in
der jugendlichen Selbstfindung gebrochen hatten. Allerdings:
Die Gr├╝nen als Partei, erst recht aber ihre Gr├╝nderinnen und
Gr├╝nder, sind inzwischen erwachsen und k├Ânnten sich die
Souver├Ąnit├Ąt leisten, die Union als potentiellen strategischen
Partner zu begreifen. L├Ąngst sind die meisten ja auch wieder in
den Scho├č ihrer b├╝rgerlichen Familien zur├╝ckgekehrt, leben
den Lebensstil, den sie in der antib├╝rgerlichen Rebellion
verworfen hatten.
Unbegreiflich ist allerdings, wie sich die gr├╝ne F├╝hrungsriege
um Joseph Fischer in den letzten drei Monaten von der SPD
vorf├╝hren lie├č, wenn es um die Zukunftsthemen Arbeitsmarkt,
Gesundheit und Rente ging. Die Wahlsieger des 22. September
backten so kleine Br├Âtchen, da├č eine Reihe aufrechter
Aufm├╝pfiger in der neuen Bundestagsfraktion zu Recht die
Sozialdemokratisierung der Gr├╝nen kritisierte, als Fischer &
Co. die Rentenbeitragserh├Âhung abnickten. Selbst beim letzten
Gr├╝nen-Parteitag in Hannover Anfang Dezember war der
Verlust des eigenen Profils, der sich hinter dem Vorwurf der
"Sozialdemokratisierung" verbirgt, das beherrschende
Meta-Thema.
Wenn man Joseph Fischer, der in Hannover selbst mit seinem
gr├╝nen ├ťbervater-Image kokettierte, nicht nur f├╝r einen
popul├Ąren, sondern auch einen intelligenten Politiker h├Ąlt, dann
kann man sich nur schwer einen Reim darauf machen, warum
er nicht merkt, wie sich die Gr├╝nen durch ihre Nibelungentreue
zur SPD best├Ąndig ihrer politischen Gestaltungsf├Ąhigkeit
berauben. Man mag nicht glauben, da├č der Au├čenminister das
gr├╝ne Projekt nur als Vehikel f├╝r seine europ├Ąischen
Karrierew├╝nsche betrachtet. Aber das w├╝rde erkl├Ąren, warum
die Gr├╝nen in Treue fest zum Etatismus der SPD stehen, nicht
einmal taktisch ihr Spielfeld in der politischen Arena erweitern
wollen.
Der Treppenwitz der gr├╝nen Sozialdemokratisierung ist in den
letzten vier Wochen zu beobachten. Gerhard Schr├Âder besetzt
pl├Âtzlich wieder mit Papieren aus dem Kanzleramt die
Reformthemen, nachdem er den Gr├╝nen in den
Koalitionsverhandlungen nicht einmal bei den Minijobs
irgendein Zugest├Ąndnis machte. Wer sich auf Gerhard
Schr├Âder verl├Ą├čt, ist manchmal ganz schnell verlassen, lieber
Joseph Fischer! Doch die gr├╝nen Altvordern haben ihren Zenit
├╝berschritten, m├╝ssen vielleicht schon im Februar nach den
Wahlen in Hessen und Niedersachsen am eigenen Leib sp├╝ren,
da├č eine gro├če Koalition in Berlin zumindest gr├╝ne
Minister├Ąmter kostet.
Die Gr├╝nen haben als politisches Projekt zuviel Substanz, als
da├č man sie - bei allen Verdiensten - nur dem Nutz und
Frommen ihres (un-)heimlichen Vorsitzenden ├╝berlassen kann.
Der ├Âkologische Urgedanke der gr├╝nen Bewegung -"Wir
haben die Erde nur von unseren Kindern und Enkeln geborgt!"
- entspricht dem christlichen Memento des"Die Sch├Âpfung
bewahren!". ├ťbersetzt auf die gigantischen Probleme aller
hochentwickelten Industriegesellschaften, die durch die Bank in
die demographische Falle der ├ťberalterung geraten, verbirgt
sich hinter beiden Metaphern der Wunsch nach einem
langfristig tragf├Ąhigen Lebensstil der Gattung Mensch in
unserer einen Welt und damit auch die Meta-Botschaft f├╝r alle
Reformkonzepte, die Sozialstaat und Eigenverantwortung neu
justieren.
Das Leben zu Lasten k├╝nftiger Generationen mu├č beendet
werden. Staatsverschuldung ist als Raubbau an unseren
Kindern und Enkeln zu diskreditieren. Anspr├╝che an den Staat
m├╝ssen massiv begrenzt werden, weil ansonsten immer weiter
steigende Steuern und Sozialabgaben die Leistungsf├Ąhigkeit von
Arbeitnehmern und Unternehmen erdrosseln. Nicht der
allm├Ąchtige Staat ist f├╝r das Gl├╝ck seiner B├╝rgerinnen und
B├╝rger zust├Ąndig, sondern die Menschen selbst sind es.
B├╝rgergesellschaft hei├čt: so wenig Staat wie m├Âglich, so viel
Staat wie n├Âtig. Subsidiarit├Ąt, nicht Vollkaskomentalit├Ąt mu├č
Leitgedanke eines neuen solidarischen Gesellschaftsvertrages
sein. Hilfe zur Selbsthilfe in famili├Ąren, nachbarschaftlichen und
kommunitaristischen Strukturen ist nur m├Âglich, wenn
staatliche Bevormundung solche Werte nicht zerschl├Ągt, wie
das Negativbeispiel der Erbenschutzversicherung mit Namen
"Pflegeversicherung" zeigt.
Auf der Werteebene l├Ą├čt sich ein schwarz-gr├╝ner
gesellschaftspolitischer Diskurs gut f├╝hren. Die
Ankn├╝pfungspunkte beim Verst├Ąndnis von der Rolle des
Staates und beim b├╝rgerschaftlichen Engagement springen
einem f├Ârmlich ins Gesicht. Auch ein gewisser
Wachstumsskeptizismus ist Gr├╝nen wie Schwarzen gemein.
Objektiv verringern alternde Gesellschaften das
Wachstumspotential einer Volkswirtschaft. Denn Sparen f├╝r
das Alter hei├čt Konsumverzicht heute. Also m├╝ssen auch
nichtmaterielle Werte wieder ins Blickfeld r├╝cken:
Nachbarschaftshilfe, ehrenamtliches Engagement, Zeit f├╝r sich
selbst und die Familie."Weniger ist mehr!" als Metapher l├Ą├čt
sich sowohl gr├╝n wie schwarz positiv beleuchten.
Wer in unserem vermachteten Parteienstaat Ver├Ąnderungen
will, wem es um die Sache, nicht um taktische Sperenzchen
geht, f├╝r den birgt eine schwarz-gr├╝ne Allianz mehr Charme,
kreative Ver├Ąnderung und gesellschaftliche Modernisierung als
alle anderen aktuellen politischen Farbkonzepte.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.01.2003, Nr. 6 / Seite 33
|
 Thread-Ansicht
Thread-Ansicht