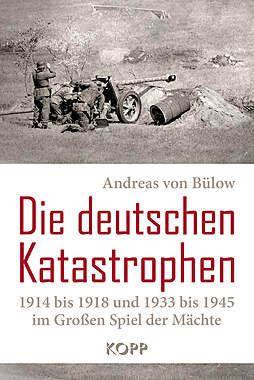-->NobelpreistrĂ€ger Milton Friedman ĂŒber Krieg, multinationale Institutionen, Steuersenkungen und den Euro
«Der Irak kann Wiederaufbau selbst finanzieren»
Der Amerikaner Milton Friedman ist einer der einflussreichsten Ă-konomen des 20.Jahrhunderts. Seine Bekanntheit verdankt er einflussreichen AnhĂ€ngern in Notenbanken und der Politik, wie Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Der radikale Verfechter wirtschaftlicher Freiheit begrĂŒndet gegenĂŒber «Finanz und Wirtschaft», wieso der Feldzug im Irak ein gerechter Krieg ist. Nach den US-Ă-konomen Fred Bergsten (vgl. Nr. 24 vom 26.MĂ€rz) und Steve Hanke (vgl. Nr. 25 vom 29.MĂ€rz) legt der NobelpreistrĂ€ger Friedman seine EinschĂ€tzungen zur globalen Wirtschaftsentwicklung dar.
Herr Friedman, Sie haben in Ihrem Leben zwei Weltkriege und unzÀhlige WaffengÀnge der Amerikaner erlebt. Was geht Ihnen angesichts des Irakkriegs durch den Kopf?
Dieser Krieg ist historisch einmalig. Noch nie hat es eine Auseinandersetzung mit einer solch langen VorankĂŒndigung gegeben. Auch sind die Ressourcen sehr unterschiedlich verteilt - und jetzt nimmt das Land mit dem grössten Potenzial seine Aufgabe als globale Ordnungsmacht wahr. Der Krieg ist eine Fortsetzung des Golfkriegs von 1991, den wir nun endlich beenden.
Ist es ein gerechter Krieg?
Auf jeden Fall, aber ich mag den Ausdruck nicht. Es geht nicht um Gerechtigkeit. Es war Saddam Husseins Fehler, seine Versprechungen von 1991 nicht einzuhalten. Das war seine freie Wahl. Ohne diese Entscheidung hÀtte es keinen Krieg gegeben.
Handeln die USA eigenmÀchtig?
Die Koalition der Willigen umfasst 45 LÀnder - das kann ich nicht eigenmÀchtig nennen. Sollte beispielsweise Deutschland vor jeder aussenpolitischen Entscheidung weltweit eine Umfrage abhalten, ob das in Ordnung geht? Warum sollten die USA das tun?
Kritiker der USA behaupten, dass es im Irak nur um Ă-l geht.
Das ist Unsinn. Wie kann es um Ă-l gehen, wenn das nach dem Krieg dem irakischen Volk gehören wird? Die USA gewinnen nichts. Die amerikanischen Truppen kĂ€mpfen nicht, um fĂŒr US-Unternehmen Zugang zu den Ă-lquellen zu erlangen. Das ist eine kompliziertere Angelegenheit. Das durch den Irak erhöhte Angebot von Ă-l senkt dessen Preis und ist gut fĂŒr die US-Wirtschaft - wirkt sich aber nachteilig auf die in Amerika fördernden Ă-lfirmen aus.
Die USA sind die einzige Supermacht in der Welt. Ist das nach Ihrer Ansicht nicht ein schÀdliches Monopol im Markt der internationalen Sicherheit? Wo bleibt der Wettbewerb?
Wettbewerb ist nicht immer gut. So sollte mit ihm zum Beispiel nicht die Frage geklĂ€rt werden, ob man auf der rechten oder der linken Seite der Strasse fĂ€hrt. Man braucht Regeln, und das ist Aufgabe des Staates. Im Moment ist es die Aufgabe der USA, in der internationalen Politik Regeln aufzustellen. Das ist eine gute Sache und stabilisiert hoffentlich die Welt. Im Ăbrigen: Monopole sind vergĂ€nglich. Sowohl China wie Indien besitzen das langfristige Potenzial, zu ernsthaften Herausforderern heranzuwachsen. Das passiert nicht ĂŒber Nacht und braucht noch mindestens zehn Jahre. China expandiert sehr rasch und ist der aussichtsreichste Kandidat.
Sind die Vereinten Nationen noch eine nĂŒtzliche Organisation?
Die Frage unterstellt, dass die Uno jemals nĂŒtzlich gewesen ist. Wann war sie das? Die Vereinten Nationen waren im besten Fall ein Ărgernis. Es war ein grosser Fehler, dass sie ihre Zentrale auf amerikanischem Boden eröffnen durften. Wir hĂ€tten sie wie andere Organisationen in Nigeria oder ganz in der Schweiz beheimaten sollen. Sie wĂŒrden viel weniger Aufmerksamkeit erhalten und weniger attraktiv fĂŒr Politiker und BĂŒrokraten sein. Die USA wĂŒrden mehr Spielraum erlangen.
Aber die Uno ist doch die Errungenschaft des 20.Jahrhunderts. Sie ist ein wichtiges Forum, um Konflikte ohne Krieg zu lösen. Was stört Sie an der Uno?
Die Uno sorgt fĂŒr Uneinigkeit. Sie fördert Zwietracht, nicht Ăbereinstimmung. Schauen Sie sich die Geschichte an: Wann haben die Vereinten Nationen eine konstruktive Rolle gespielt? Etwa in den afrikanischen Konflikten? Oder in Bosnien? Nicht im geringsten. Wie kann man eine Organisation ernst nehmen, die Kamerun und den USA jeweils eine Stimme verleiht? Die Libyen den Vorsitz fĂŒr die Menschenrechtskommission gibt? Das Uno-Prinzip, jeder Nation - ob gross oder klein, demokratisch oder autoritĂ€r - eine Stimme zu geben, fĂŒhrt in die Irre.
Das sind starke Worte, bei denen Nicht-Amerikanern der Atem stockt.
Die Uno funktioniert nicht. Es ist das Gleiche wie mit den anderen internationalen Organisationen: Der Internationale WĂ€hrungsfonds sollte abgeschafft werden. Die Weltbank schadet mehr, als dass sie hilft. Das Gleiche gilt fĂŒr die Uno. Aber ich sehe ein, das wir mit ihr leben mĂŒssen und eine Schliessung kaum möglich ist.
Warum sollen WĂ€hrungsfonds oder die Weltbank weg?
Wir brauchen keine Organisationen - der Markt kann das allein regeln. Der IWF versucht sich als Global player auf dem Devisenmarkt, die Weltbank mischt sich mit internationalen Direktinvestitionen ein. Beides hat vor dem IWF und der Weltbank existiert. Im 19. und 20. Jahrhundert hat es auch ohne diese Institutionen Wechselkurse und KapitalflĂŒsse gegeben. Obendrein werden WĂ€hrungsfonds und Weltbank von nicht gewĂ€hlten Gremien geleitet. Amerikanische BĂŒrger sollten kein Geld mehr an undemokratische Einrichtungen zahlen.
IWF-Kredite sind in EntwicklungslÀndern nicht wegzudenken.
IWF-Kredite transferieren Geld von armen Menschen in reichen LĂ€ndern zu reichen Menschen in armen LĂ€ndern. Ist Argentinien eine Erfolgsgeschichte? Die UnterstĂŒtzung durch den WĂ€hrungsfonds erlaubte es der argentinischen Regierung, eine falsche Wirtschaftspolitik viel lĂ€nger zu verfolgen, als sie es sonst hĂ€tte tun können. Es ist sonnenklar, dass der Markt dort viel effizienter gewirkt hĂ€tte. Das gilt fĂŒr andere LĂ€nder genauso.
Entwicklungshilfe mĂŒsste also auch verschwinden?
Das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Es gibt politische Hilfe, die ich begrĂŒsse. Aber das meiste an Entwicklungshilfe lehne ich ab. Sie stĂ€rkt die Regierungen in LĂ€ndern, in denen der Staat ohnehon schon zu viel zu sagen hat, und ist verantwortlich fĂŒr den Niedergang vieler EmpfĂ€ngernationen. Die meisten erfolgreichen EntwicklungslĂ€nder haben keine oder nur wenig UnterstĂŒtzung erhalten.
Dann sind Sie auch gegen Aufbauhilfen an den Irak?
Der Irak sollte sich selbst helfen. Das Land besitzt reichlich Ressourcen, nicht zuletzt das Erdöl. Das Geld aus den irakischen Quellen reicht völlig aus.
Die GrĂŒndung von IWF und Weltbank 1944 basiert auf der Blaupause eines berĂŒhmten Kollegen von Ihnen. John Maynard Keynes vertrat die Ansicht, die Politik mĂŒsse den Markt korrigieren.
Er war ein grossartiger Ă-konom. Seine Theorien von Arbeitsmarkt und Geld waren ausgeklĂŒgelt und erfinderisch. Aber sie sind von der Geschichte widerlegt worden und haben in der heutigen Welt sehr wenig Relevanz.
Gleicht aber nicht das von PrÀsident Georg W. Bush vorgeschlagene US-Budget dem Versuch, der Wirtschaft à la Keynes unter die Arme zu greifen?
Keynes will die Einkaufskraft der Konsumenten stĂ€rken. Angebotstheoretiker wollen Anreize fĂŒr Menschen schaffen, damit sie mehr arbeiten, produzieren und investieren. Von daher bin ich sehr zufrieden mit den vorgesehenen SteuerkĂŒrzungen. Ich muss aber zugeben, dass sich die USA wie die meisten anderen LĂ€nder viele VersĂ€umnisse vorzuwerfen haben. Der freie Handel wird unterdrĂŒckt. Die Importquoten auf Zucker beispielsweise sind ebenso falsch wie die Zölle auf Produkten wie Stahl, die US-PrĂ€sident George W. Bush letztes Jahr einfĂŒhrte. Das war ein grosser Fehler.
Wie schĂ€tzen Sie die Aussichten fĂŒr die US-Wirtschaft ein?
Die Volkswirtschaft wÀchst, aber langsam und schwankend auf Grund der Unsicherheit, die der Terrorangriff am 11.September und der Krieg auslösten. Sobald aber die Frage um den Irak gelöst ist, erwarte ich eine deutliche Verbesserung. Die Wirtschaft ist im Grunde genommen gesund. Es wird eine hohe ProduktivitÀt erzielt, es herrschen niedrige Inflation und wenig Arbeitslosigkeit.
Damit steht der Dollar vor einem Comeback?
GegenĂŒber dem Euro verlor der Dollar in jĂŒngster Zeit deutlich an Wert. Ich erwarte, dass sich die Entwicklung sehr bald sehr schnell umkehrt. Der Euro ist ĂŒberbewertet, und das Ă€ndert sich im nĂ€chsten Jahr. Europa befindet sich gegenĂŒber den USA in einer viel schlechteren Verfassung. Besonders Deutschland kĂ€mpft mit Problemen wie hoher Arbeitslosigkeit und Inflation, die Wirtschaft zeigt kaum Lebenszeichen. Deutschland ist mit einem viel zu hohen Wechselkurs in den Euro gegangen und zahlt nun den Preis dafĂŒr.
Glauben Sie, dass England dem Euro beitritt?
Daran hege ich grosse Zweifel. Die jĂŒngsten Differenzen zwischen Blair und Chirac vernichteten fĂŒr geraume Zeit jegliche Perspektive. Das ist meiner Meinung nach das Beste, was England passieren konnte. Ohne den Euro wĂŒrde es auch Deutschland besser gehen. Die Wechselkurse passen nicht zu den einzelnen wirtschaftlichen UmstĂ€nden der LĂ€nder wie Deutschland oder Irland.
Halten Sie weiter fest an Ihrer Prognose von vor einem Jahr, dass der Euro in spĂ€testens fĂŒnfzehn Jahren auseinanderbricht?
DafĂŒr stehen die Chancen weiterhin gut. Ich bin sehr skeptisch gestimmt, was die langfristigen Aussichten des Euros betrifft.
Wie schĂ€tzen Sie den Dollar gegenĂŒber dem Yen ein?
Das hĂ€ngt von der Entwicklung Japans ab. Ich bin optimistisch. Das Land machte eine sehr schlechte Zeit durch, durchschreitet aber derzeit den Tiefpunkt und schafft den Turnaround. Die Japaner arbeiten einige der faulen Kredite ab, die die Banken und das ganze Land paralysieren. Sie sind kurz davor, eine wirksame Reform des Bankensystems durchzufĂŒhren. Das ist der SchlĂŒssel zum Turnaround. Japan ist ein reiches Land mit viel Wachstumspotenzial - das mehr als zehn Jahre unterdrĂŒckt wurde. Sobald Japan aus der Depression ausbricht, wird es jeden ĂŒberraschen, wie rasch es wĂ€chst. Interview: Thomas Jahn, New York
Zur Person
Mit seinen Gedanken zum Staatsversagen und der Ăberlegenheit des Markts verĂ€nderte der 90-jĂ€hrige Milton Friedman das Denken von Regierungen und Notenbanken in aller Welt. Friedman beriet die US-PrĂ€sidenten Ronald Reagan und Richard Nixon in Wirtschaftsfragen. Von 1946 bis 1983 war Friedman Professor in Chicago. 1976 erhielt er den Nobelpreis fĂŒr Wirtschaftswissenschaft. Seine wichtigsten BĂŒcher sind «Capitalism and Freedom», «Free to Choose», «Monetary History of the United States 1867-1960». Der Ă-konom lebt heute in San Francisco und arbeitet an der Hoover Institution der Stanford University. Derzeit setzt er sich intensiv mit dem Thema Chancengleichheit in der Bildung auseinander.
Quelle: Finanz und Wirtschaft, 2. April 2003
|
 Thread-Ansicht
Thread-Ansicht