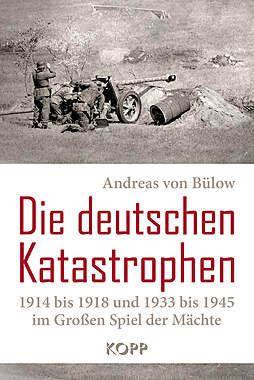-->Die Neue Institutionenökonomik verÀndert das Denken von Wissenschaftlern und Politikern. Ihr Credo: Freie MÀrkte allein reichen nicht. Eine Volkswirtschaft ist nur so gut wie ihre Behörde, Regeln und Gepflogenheiten
Von Arne Storn
Anfang der Neunziger trÀumen sie alle denselben Traum. Die Menschen im Osten Europas wollen reich werden. Jahrzehntelang haben sie unter dem Kommunismus gelitten, aber das ist nun vorbei. Die Marktwirtschaft hÀlt Einzug in LÀndern wie Georgien, Bulgarien, die Ukraine und Russland. Der Traum soll endlich Wirklichkeit werden.
Schön wĂ€râs gewesen. In dem in diesen Tagen von politischen Unruhen geschĂŒttelten Georgien zum Beispiel ist das Bruttoinlandsprodukt in den ersten zehn Jahren nach dem Ende der Planwirtschaft um 70 Prozent gefallen. In Bulgarien und der Ukraine um rund 40 Prozent. In Russland prĂ€gten jahrelang ProvinzfĂŒrsten und Sicherheitsdienste das Bild, das Bruttoinlandsprodukt sank auch hier. Kurz, in zahlreichen LĂ€ndern des ehemaligen Ostblocks wurden die Menschen trotz der EinfĂŒhrung des Kapitalismus nicht reicher, sondern Ă€rmer. Was war passiert?
Ă-konomen und Regierungschefs haben beim Systemwechsel etwas Wichtiges ĂŒbersehen. Nach 1990 sollten fiskalische Disziplin, Privatisierung und Deregulierung dem gesamten Ostblock Wohlstand bringen. Der Amerikaner Jeffrey Sachs, damals Wirtschaftsprofessor in Harvard und Berater vieler osteuropĂ€ischer Politiker, war ĂŒberzeugt, dass die Gesetze und Regeln, die sich in anderen LĂ€ndern bewĂ€hrt hatten, ĂŒbertragbar seien. Die Mechanismen des freien Marktes wĂŒrden dann fĂŒr Wohlstand sorgen. Dass es anders kam, dafĂŒr liefern neue Studien des amerikanischen National Bureau of Economic Research eine ErklĂ€rung, die immer mehr Ă-konomen ĂŒberzeugt: Systemwechsel schaffen zwar die Voraussetzung fĂŒr einen Wandel, ĂŒber den wirtschaftlichen Erfolg einzelner LĂ€nder wĂŒrden aber vor allem die Institutionen entscheiden.
Institutionen? Ein Begriff, der an Behörden und BĂŒrokraten denken lĂ€sst, fĂŒr Ă-konomen jedoch alle Regeln und Arrangements umfasst, die menschliches Handeln beeinflussen. Verordnungen, Gesetze, aber auch Unternehmen zĂ€hlen zu den formellen Institutionen. Traditionen, soziale Normen und MentalitĂ€ten zu den informellen Institutionen. Sie alle haben in der dominanten ökonomischen Theorie, der Neoklassik, die als Blaupause fĂŒr die Reformen Osteuropas diente, keinen Platz. Anders in der âNeuen Institutionenökonomikâ (NIĂ-). Dort stehen sie im Mittelpunkt.
Sie könnten die gesamte Wirtschaftswissenschaft verÀndern.
âInstitutions matterâ, das sei der wichtigste Satz der NIĂ-, sagt Martin Leschke von der UniversitĂ€t Bayreuth. Beispiel Georgien: 1998 sollten alle Richter des Landes zeigen, dass sie die von westlichen Beratern entworfenen neuen Landesgesetze beherrschen. Nur ein Drittel bestand den Test. âDas Ziel, Rechtssicherheit fĂŒr wirtschaftliche Akteure zu schaffen, ist noch nicht erreicht wordenâ, heiĂt es denn auch in einer Bewertung des deutschen Entwicklungshilfeministeriums. Nach Ansicht der NIĂ- wiegt ein solches Defizit schwerer als die Frage nach SteuersĂ€tzen oder Zinshöhen.
Ganz neu ist dieser Ansatz nicht: Schon die Historische Schule des deutschen Ă-konomen Gustav Schmoller (1838 bis 1917), die Ordnungspolitik Walter Euckens (1891 bis 1950) oder die âalten Institutionalistenâ John Commons (1862 bis 1945) und Thorstein Veblen (1857 bis 1929) hatten sich mit Institutionen befasst. Sie entwickelten jedoch keine umfassende Theorie und blieben AuĂenseiter ihrer Zunft: Im neoklassisch geprĂ€gten wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream kommen Institutionen praktisch nicht vor. Zwar wird analysiert, wie Angebot und Nachfrage auf dem Markt zusammentreffen und ĂŒber Preise zum Ausgleich kommen. Was aber die Institution âMarktâ begrĂŒndet, welche Rolle etwa die Rechtsprechung oder die gesellschaftliche Tradition des jeweiligen Landes spielt - dazu findet sich in LehrbĂŒchern wenig.
Heute zeigen sich von diesem Mainstream dominierte Organisationen wie der Internationale WĂ€hrungsfonds (IWF) reuig. âDer IWF hat in der Vergangenheit die Rolle gesunder Institutionen und der Rechtssicherheit fĂŒr eine funktionierende Marktwirtschaft unterschĂ€tztâ, rĂ€umt IWF-Chef Horst Köhler inzwischen ein. Auch die Schwesterorganisation des IWF, die Weltbank, spricht Institutionen eine entscheidende Rolle bei der BekĂ€mpfung der Armut zu.
Nicht zu Unrecht. In EntwicklungslĂ€ndern kĂ€mpfen viele Menschen ums Ăberleben, sie können weder lesen noch schreiben und haben wenig Geld. Doch unsinnige staatliche Vorschriften machen ihnen das Leben oft noch schwerer. In Mosambik etwa braucht es fĂŒnf Monate, 19 Schritte und die HĂ€lfte des durchschnittlichen Jahreseinkommens, um ein Gewerbe anzumelden - in Australien sind es zwei Tage, zwei Schritte, zwei Prozent. Kein Wunder, dass in armen LĂ€ndern viele Menschen die unsicheren informellen Institutionen den staatlichen vorziehen, dass sie illegale Felder bestellen, illegale GeschĂ€fte betreiben, in illegalen UnterkĂŒnften leben. Keine Ăberraschung, dass so oft empfohlene wirtschaftspolitische MaĂnahmen wie etwa Steuer- oder Zinssenkungen keine Wirkung zeigen.
Ohne Rechtstitel, ohne funktionierende Rechtsprechung kann schlieĂlich niemand sein Eigentum mit Krediten belasten, wird niemand gröĂere Investitionen tĂ€tigen oder darauf hoffen, sich im Streitfall vor Gericht durchzusetzen. Korruption, ineffiziente Behörden und inkompetente Richter verhindern zwar nicht das Entstehen von Kapital: Der Grundbesitz, ĂŒber den Arme de facto verfĂŒgen, ohne entsprechende Rechtstitel zu besitzen, entspricht dem enormen Wert von 9,3 Billionen Dollar. Der peruanische Ă-konom Hernando de Soto, der mit dieser Zahl und dem Buch The Mystery of Capital vor drei Jahren Furore machte, bezeichnet das jedoch als âtotes Kapitalâ. Tot, weil nicht sichtbar, nicht nutzbar. De Soto fordert daher formale Eigentumsrechte. Sie erleichtern den Austausch von Eigentum, reduzieren die Transaktionskosten. So nennen Institutionenökonomen die Hindernisse, die ein reibungsloses Funktionieren des Marktes erschweren.
In der Neoklassik hat diese Art von Kosten keinen Platz. Sie arbeitet mit dem Konstrukt des vollkommenen Marktes. Anbieter und Nachfrager handeln vollkommen rational, verarbeiten alle Daten sofort und ohne Aufwand. Dass Vertragspartner gesucht, VertrĂ€ge ausgehandelt werden mĂŒssen und ihre Einhaltung kontrolliert werden muss, dass Transaktionen Kosten verursachen und Institutionen diese Kosten beeinflussen, wird nicht beachtet.
Erst der Amerikaner Ronald Coase fĂŒhrte die Transaktionskosten in die ökonomische Theorie ein: In seinem Aufsatz The Nature of the Firm untersuchte er schon 1937 die simple, in der reibungsfreien Welt der Neoklassik aber nicht zu beantwortende Frage, warum es Unternehmen ĂŒberhaupt gibt. Nach Coase entstehen Firmen, wenn die Kosten einer Transaktion bei einer Abwicklung ĂŒber die Institution âMarktâ höher sind als bei einer Abwicklung ĂŒber die Institution âFirmaâ. In diesem Fall wird der Mechanismus des Preises durch den Mechanismus der Hierarchie ersetzt, die unsichtbare Hand durch den sichtbaren Zeigefinger.
Rund 50 Jahre sollte es dauern, bis Coase auf nennenswerte Resonanz stieĂ. Anfang der achtziger Jahre organisierte Rudolf Richter von der Uni SaarbrĂŒcken âdie damals einzige internationale Konferenzâ ĂŒber die NIĂ-, aus einer alten deutschen Publikation machte er âunter dem Murren meiner Kollegenâ das Journal of Institutional and Theoretical Economics - bis heute wichtigstes Forum der Szene. Oliver Williamson entwickelte aus den Ideen von Coase ein Spektrum institutioneller Arrangements im Firmenbereich, Douglass C. North befasste sich mit Einfluss und Wandel gesellschaftlicher Institutionen. Dann kam der Durchbruch: 1991 erhielt Coase, 1993 North den Ă-konomienobelpreis.
Inzwischen sind die Gedanken der NIĂ- auch in der Betriebswirtschaftslehre weit verbreitet. WĂ€hrend die Firma in der Neoklassik eine Black Box ist, lassen sich in der NIĂ- die Unternehmen als Organisationen verstehen - ihr Innenleben wird dadurch analysierbar, ebenso zwischen Markt und Integration angesiedelte Hybridformen wie Franchising oder Joint Ventures. Zudem scheinen vertikale ZusammenschlĂŒsse nicht mehr per se wettbewerbsschĂ€digend, sondern potenziell Transaktionskosten senkend und sinnvoll. âDas hat die Wettbewerbspolitik in den USA verĂ€ndertâ, sagt Stefan Voigt von der UniversitĂ€t Kassel.
In einer Welt der Transaktionskosten sind, anders als in der Neoklassik, vollstĂ€ndige VertrĂ€ge nicht mehr denkbar. SchlieĂen der Auftraggeber, der âPrinzipalâ, und der Auftragnehmer, der âAgentâ, einen Vertrag, so kann der Prinzipal den Agenten nur partiell einschĂ€tzen und kontrollieren, die Informationen sind asymmetrisch verteilt. In der NIĂ- wird den Menschen zudem opportunistisches Verhalten unterstellt - Egoismus unter Zuhilfenahme von List. Eine nicht ganz unrealistische Annahme: Arbeitnehmer wollen ihren Lohn ohne Aufwand einstreichen, Manager denken an Aktienoptionen statt ans Bilanzrecht.
Entsprechend sorgfĂ€ltig sind Anreize zu setzen, sind unvollstĂ€ndige VertrĂ€ge optimal zu gestalten - neben der Theorie der Eigentumsrechte und dem Transaktionskostenansatz bildet die Principal-Agent-Theorie das dritte Kernthema der NIĂ-. Deren Einfluss reicht bis in die Politik. âDas neue deutsche Insolvenzrecht von 1999 wĂ€re in dieser Form ohne institutionenökonomische Ăberlegungen nicht zustande gekommenâ, sagt Werner Neus von der UniversitĂ€t TĂŒbingen. Beispielsweise werde ein insolventer Privatmann heute von seinen Schulden befreit, wenn er sich sieben Jahre lang bemĂŒht hat, seine Verbindlichkeiten zu begleichen - als Anreiz, sich ĂŒberhaupt anzustrengen.
So nimmt die NIĂ- inzwischen auf reale Politik Einfluss, und ihre BefĂŒrworter hoffen, dass sie auch innerhalb der Wirtschaftswissenschaften an Gewicht gewinnt. âEs ist ein neuer Denkstilâ, sagt der SaarbrĂŒcker Professor Rudolf Richter, der bis heute wichtigste deutsche Vertreter der NIĂ-. âWir stehen am Anfang eines neuen Paradigmas.â
Es geht um AnstöĂe im Kleinen wie im GroĂen. Matthias Erlei von der Technischen UniversitĂ€t Clausthal setzt vor allem auf die Verbindung mit der experimentellen Forschung. Diese untersucht, wie menschliche PrĂ€ferenzen und Entscheidungen entstehen, und erprobt die These, dass der Mensch kein vollkommen rationaler Homo oeconomicus, sondern ein Wesen mit eingeschrĂ€nkter RationalitĂ€t und Voraussicht ist.
Fundamentale Fragen auch im GroĂen. âDurch den Transaktionskostenansatz lassen sich Begriffe wie Vertrauen, Reputation oder Moral in die Sprache der Ă-konomie ĂŒbersetzenâ, sagt Elisabeth Göbel von der Uni Trier. Begriffe, die geringe Reibungsverluste und damit wirtschaftlichen Erfolg erklĂ€ren. Und so zĂ€hlen die innere Motivation und die Unternehmenskultur, die informellen Institutionen und Netzwerke, das âSozialkapitalâ einer Gesellschaft, zurzeit zu den Themen. Mehr als 600 Studien veranlassten Williamson im Jahr 2000 zu der Aussage, die Transaktionskostenökonomik sei âeine empirische Erfolgsgeschichteâ.
NIĂ--Vordenker Richter glaubt, dass Transaktionskosten und beschrĂ€nkte RationalitĂ€t die Ă-konomie fundamental verĂ€ndern werden. Auch North hĂ€lt die herrschende Doktrin des vollkommen rationalen Menschen nur fĂŒr begrenzt fruchtbar, Neoklassik und NIĂ- letztlich nicht fĂŒr vereinbar, wĂ€hrend jĂŒngere Vertreter pragmatischer sind. Eine Reihe von Forschern meint, die NIĂ- könne einmal das Dach der Sozialwissenschaften bilden - auch Juristen, Politologen und Soziologen arbeiteten mit der Kategorie der Institution. Wichtiger noch könnte ein anderer Aspekt sein. âDie NIĂ- vergleicht reale ZustĂ€nde nicht mit einem Ideal wie die Neoklassik, sondern mit anderen realen oder realisierbaren ZustĂ€ndenâ, sagt der Kasseler Forscher Stefan Voigt.
Vielleicht kann die NIĂ- der Ă-konomie so zurĂŒckgeben, was ihr selbst einige Ă-konomen heute absprechen: Relevanz.
(c) DIE ZEIT 27.11.2003 Nr.49
|
 Thread-Ansicht
Thread-Ansicht